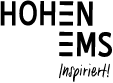Cara Roberta. Antonie Schneider & Hansjörg Quaderer

Weiler im Allgäu, Dienstag, den 30.6. – 1.7.2020
Lieber Hansjörg,
es ist der letzte, der 10. Brief, den wir uns schreiben.
Ich sage ganz einfach nun, den wir uns schreiben.
Aus dem behutsamen Herantasten, Entschlüsseln der Zeichen, den kleinen Wegmarken, …die Spuren zu lesen, wo einer gegangen, ist ein Gehen geworden, ein Gespräch zwischen Ich und Du, dass ein Gespräch wir sind, schrieben Sie einmal.
Ich glaube, wir sind es geworden, ein Gespräch.
Wenn es nur überall so sein könnte, dass wir die gereichten Fäden aufnehmen, ganz gleich, ob sie bruchstückhaft, fadenscheinig, dünn, abgerissen oder farbig sind. Dass so etwas entsteht, wie es gekommen ist! Ich nehme es als Geschenk, als etwas Unerwartetes, aus einem Wagnis heraus, auf das wir uns eingelassen haben.
Es erscheint mir, dass sich etwas Buntes, Fremdes, Vertrautes und Durchlässiges, in der uns gemeinsam anvertrauten Landschaft entwickelt hat,
wie durch Kunst unser Leben zu lesen. Sie nannten u.a. Morandi in seiner Abgeschiedenheit und Stille. Ja, Bologna taucht da plötzlich in meiner Erinnerung auf. Dieses ferne, nahe Licht, dieses nahe, ferne Licht.
Als ich am Morgen erwachte, legte sich das Licht so weich im Gesang der Vögel in die Zweige der Birke und auf die roten Ziegeldächer der Gehöfte. Italien, dachte ich. Der Ruf der Turteltaube ist nicht fern und die Geschäftigkeit des Bauens, das Palaver, das blecherne Geräusch der Stahlgerüste…
Mein Blick geht zum Bücherregal. Ein blauer mit Teeflecken versehener Umschlag eines Gedichtbandes aus dem Lyrikkabinett mit dem Titel: Nimm mein Wort in die Hand, springt mir ins Auge, D.H. Lawrence von Werner Koppenfels ausgewählt und übertragen.
Ich lese erstaunt:
Nicht ich, nur der Wind, der durch mich hindurch weht!
Ein feiner Wind zeigt im Wehen die neue Richtung der Zeit.
Wenn ich mich nur von ihm nehmen lasse, tragen lasse, wenn er mich nur tragen will!…
Die Glocken der Kapellen läuten heute früh ganz anders als sonst, einsilbig, ja, eintönig, als ob sie Trauer tragen um diese ungewöhnliche Zeit.
Halblaut lese ich
O, dem Wunder, das in meine Seele sprudelt,
wär ich ein guter Brunnen, ein guter Quell,
würde kein Wispern verwischen keinen Ausdruck verpfuschen.
Was soll dieses Klopfen?
Was soll dieses Klopfen, des Nachts an der Tür?
Da ist jemand, der will uns schaden.
Nein, nein, es sind die drei fremden Engel.
Lass sie ein, lass sie ein.
Und ich halte Ausschau, wie von einem Leuchtturm aus, staunend auf all die Landschaften der Sprache, die sie mir aufzeigt und Sie mir aufzeigten.
Ihrem Freund möchte ich tröstlich antworten, es kann wieder gut werden, auch mit einem Lungenflügel, in einer achtsamen Verlangsamung, weil ich dies selbst bei einer Freundin erlebt habe.
Meine Seele hört im Sehen –
heisst eine der neun deutschen Arien von Georg Friedrich Händel, gedichtet von dem Barockdichter Barthold Heinrich Brockes.
Was aber bleibet, stiften die Dichter, sagt Hölderlin und spricht uns dies nicht auch der junge Dichter Raoul Eisele ebenso zu. Und das Leben, das plusterndemit dem Duft des Brotes, mit Linas Garten und all den alltäglichen Wunder. Wenn uns die Sprache zum Instrument wird, zur verwandelnden Kraft, den Ton zum Singen bringt vom Sommer, dem alterslos Schönen, auch in diesem Jahr.
Gestern sah ich den Dokumentarfilm über Itzhak Perlman: „Ein Leben für die Musik“. Mir blieben nur die Worte Seele und Schönheit haften. So kann nur einer spielen, der hindurch tönt und eins ist mit seinem Instrument. Da ist auch Itzhak Perlmans entwaffnende Menschlichkeit, seine Leidenschaft zum Kochen, jenes geheimnisvolle Bereiten der Mahlzeit. Ob es mit Worten, Tönen, gutem Essen, gutem Wein und Gesprächen geschieht, mit aller Süssigkeit und Bitterkeit der Kräuter und Gewürze. Dieses sich versammeln um den gedeckten Tisch des gemeinsamen Schicksals. Wir mit unseren Geschichten und unserer Geschichte, wir sind alle mit dabei.
Miriam Pressler schrieb einmal in einem Nachwort einer Sammlung von Gute-Nacht Geschichten, dass Geschichten Mahlzeiten für die Seele sind.
Wir tragen sie in uns, entdecken sie, tragen Schichten ab, fügen neue hinzu, wir rasten, halten Ausschau, verändern den Blick, finden Gefährtinnen und Gefährten.
Es ist früher Morgen. Die Vögel singen um die Wette oder einfach nur so, weil sie da sind?
Ich denke an Beethovens Streichquartett Nr.14 cis-Moll op.131, ein spätes Werk, denke an seine Taubheit an seine drei innigen Briefe für Bettine.
Das Belcea Quartet vor zwei Tagen hörte ich mit der rumänischen Violinistin im Garten mit Kopfhörern, es hat mich zutiefst ergriffen, als Atem, als Sauerstoff, der verwandelt.
Immer sind es doch die Geschichten, die wir miteinander teilen. Es sind nicht die grossen Bauwerke, sie vergehen, sagt ein altes afrikanisches Sprichwort. Die Zunge bleibt in den Märchen und Liedern.
Sie schrieben, dass ein Zwischenboden in Ihrem Atelier eingezogen wird, eine Art Empore, die Veränderung ermöglicht.
Alles Gute für das Atelier, eine Empore ist etwas, was den Blick verändert.
Ich bin dabei meine Korrespondenzen zu ordnen, zu sortieren, zu vernichten, zu behalten, im Gedächtnis zu behalten, was das Herz bewegt.
Eine Schweizer Freundin sagte mir einmal, wir feiern „Gedächtnis“.
Ich kannte diesen Ausdruck und den dazugehörigen Brauch nicht. Jene im Gedächtnis zu behalten, die nicht mehr sind und ich füge hinzu, und jene die sind.
Ich freue mich, Ihnen begegnet zu sein und Ihnen auch bald leibhaftig im Literaturhaus in Liechtenstein zu begegnen.
Danke für Ihre guten Wünsche zum Buchstabieren meiner Stadt, vielleicht wird dieses Buchstabieren nur für mich sein.
Ich schaue aus dem Fenster, verwundert, der Himmel blau mit zarten, weissen, spielerischen Wolken. Das Sfumato ist verschwunden, klar sind die Konturen der Hügel und Häuser.
Alles Wirkliche ist Begegnung, schreibt Martin Buber, es stimmt, füge ich hinzu,
Ihre Antonie
Die Türen des Jahres öffnen sich,
wie die der Sprache,
dem Unbekannten entgegen.
Gestern Abend sagtest du mir:
Morgen
gilt es ein paar Zeichen zu setzen,
eine Landschaft zu skizzieren, einen Plan zu entwerfen
auf der Doppelseite
des Papiers und des Tages.
Morgen gilt es,
aufs Neue,
die Wirklichkeit dieser Welt zu erfinden…
Oktvio Paz
24.-29. juni 2020
liebe antonie,
sie beobachten die neugierde des kernbeissers, das aufgeschlagene märchenbuch, fragen, ob man dem sommer trauen kann? die wucht des grüns lindert. schafft ein auf- und durchatmen. sie nehmen mich mit auf einen weg, dem ich gerne folge. inspirierend, wie sie an (der) hand von gedichten gehen, sie erzeugen ein munteres intérieur. ein gehen und aufeinander eingehen, fernmündlich, quellschriftlich. ein binnenweg tut sich auf, begleitet von achtsamkeit in der sprache. ein austausch, den ich schon nicht mehr missen möchte. er geht weit über das «cara roberta…» – briefkontingent hinaus: briefe «in der muttersprache von poesie».
ich komme ins epistolare sinnieren. das „hochzusammengesetzte“, was man von zahlen behaupten kann, zeichnet briefe aus, der wechsel, das momentum, die taktung. sich treiben lassen. gedankensprünge zulassen. – wie sie, habe ich mich sehr über die unverhoffte zuschrift von raoul eisele gefreut, der unserem briefwechsel gefolgt ist, was konturen eines weiteren gesprächs angenommen hat, das unabsehbare kreise zieht. – briefe sind eigentliche sprechversuche. allererste sprechversuche von einer primordialen verfasstheit. die sprachfindung ausgesprochen im begriff «sprechversuch» klingt «sprechen» & «vers» & «suche» an. das briefeschreiben mit der öffentlichkeit im seitenwagen ist vielleicht nichts anderes als das metier des literaten.
das memento mori, die todesfälle von christo und alfred kolleritsch. beides verwandlungs-künstler: christo, der das verhüllen als enthüllen praktizierte. der dichter ganz anders, z.b. durch «die einübung in das vermeidbare».
das leben treibt ein kurioses billardspiel. die kugeln klicken, die impulse sprühen, die winkel treiben ein symmetrisch-assymetrisches spiel. kein wort, keines ist gering genug. man beginnt zu oszillieren, zu pulsieren, möchte auf wege warten, bildhaftiges wieder gewinnnen, empfänglichkeiten und hellhörigkeiten auskosten, warten, bis sich ein oberton einstellt.
ich liebe das poröse in der malerei, das durchlässige bei cézanne, morandi, die chromatische dichte bei vermeer, giorgione, velazquez, sodass einem augen aufgehen für ein schauendes continuum, einer endlosschlaufe gleich.
ihre erwähnung von kirchenfenstern, die aus 1000 lungenflügel-röntgenaufnahmen zusammengesetzt sind, erinnert mich schmerzhaft daran, dass heute einem freund ein lungenflügel entfernt werden muss, mit langzeitfolgen, (wenn er es, so hoffe und wünsche ich es innigst, überlebt). das durchleuchten der lungenkavernen, das durchleuchten generell kann ich darum nicht bloss als gestalterisches prinzip sehen. es bleibt für mich ein persönlicher schatten hängen. so oder so: ohne flügel ist man arm dran. die flügel-obsession, den flügelschlag der erica pedretti kann ich immer besser verstehen.
die erinnerung an die davoser schatzalp mit den bedrängenden räumlichkeiten des lungensanatoriums, öffnet wiederum eine andere assotiationsreihe. das ringen um elementaren atem ist in gewissem sinn ein leitmotiv der epoche. mir kommt jean-henri fabre in den sinn, der formidable insektenkundler und eminente schriftsteller, es gibt einen kleinen essay von ihm zur luft, «die luft.l’air- necessaire a la vie», ein heft, das 2013 in der friedenauer presse erschienen ist. in der ihm eigenen anschaulichkeit schreibt j.-h. fabre: «atmen bedeutet verbrennen. von zeit zu zeit hat man bildlich von der flamme des lebens gesprochen, und es trifft sich nun, daß dieser ausdruck ein genauer ausdruck der wirklichkeit ist. – … das essbare ist das brennbare – le comestible est le combustible. die luft gelangt ihm durch die atmung in die lunge. dort löst sie ihren sauerstoff im blut auf, das plötzlich statt der schwärzlichen farbe, die es zunächst hatte, von einem schönen rot ist. mit sauerstoff angereichert, breitet sich das blut dann mittels der kanäle, die man arterien nennt, durch den ganzen körper aus». (j.-h. fabre, die luft)
es geht in unserem tun eigentlich permanent um sauerstoffanreicherung.
in diesen tagen wurde ich zeuge einer hausräumung eines ca. hundertjährigen stattlichen arzthauses. ich wurde gebeten, die sporadisch-vorhandene bibliothek durchzusehen und das brauchbare bitte mitzunehmen. der unverhoffte fund von 7 kinderbuchklassikern in exzellentem zustand und erstauflagen hat mich besonders gefreut. bücher, die sich so unscheinbar als mit schutzpapier eingeschlagene hefte präsentierten, was den tadellosen zustand erklärt: darunter «blondchen in blüten». bilder von elsa beskow. reime von georg lang», oder «weißt du wieviel sternlein stehen?» nach einem entwurf von anneliese von lewinski und versen von gertrud j. klett, und noch ein anderes hatte es mir besonders angetan: «prinzesschen im walde» von sibylle v. olfers mit dem herrlichen blatt des raben als lehrer:
«auf schwarzer tafel mit goldenem rand
schreibt das prinzeßchen mit emsiger hand.
herr lehrer rabe mit seinem buch,
der macht das prinzeßchen sehr weise und klug.»
die erfahrung, etwas zu finden, das man gar nicht gesucht hat, ist allemal beglückend.
der alltag plustert sich mit einer gewissen erleichterung auf. noch wird man z.b. gebeten „beim marile“, dem winzigen ladenlokal der bäckerei in meiner strasse, einzeln einzutreten. eine fast unsichtbare plexiglaswand wurde über dem ladentisch installiert, schiebt sich vor den duft des brots. der alltag hat leicht klinische attitüden bekommen. man „operiert“ im gewöhnlichen. nur eben: dienst und leben nach vorschrift, behagt keinem, auch wenn es seine bewandtnis hat. man simuliert normalität. – schlitzohrige katzen schleichen ums haus. diffuse geräusche, nachbarsstimmen, ein sorglos knisterndes radio. lina in ihrem wundergarten, der mich an den zöllner rousseau denken lässt. sie lässt es wuchern und verhält sich grosszügig. die geometrie der zugangspfade verleiht der szenerie eine wilde strenge. die ältere frau macht einen verwilderten, geisterhaften eindruck. gut zu wissen, dass da jemand so grosszügig gegensteuert und den garten als oase im dorf bestellt. – man ist gleich etwas nachsichtiger, wenn die nervtötenden rasenmäher rumoren.
endlich komme ich auf die feine bachmann-lesung von helga schubert, en plein air, virtuell aus ihrem garten übertragen, zu sprechen, worauf sie mich aufmerksam machten. für sie in gewissem sinne eine wiederbegegnung, da es konkrete verlagsberührungspunkte gab. – es ist leider nicht immer so, dass kühne texte das rennen machen in der zirkusmanege der kritikerinnen, die sich so gerne kaprizieren und „das männchen“ machen. in diesem fall hat frau schubert zurecht „das rennen“ des preislesens gemacht. schön und gerecht, dass sie überhaupt, diese späte, zweite chance bekommen hat. ihre ruhige, bedachte art, der tonfall ihrer vielschichtigen erinnerungen an die mutter haben mich völlig überzeugt.
so etwas wie eine sommerpause naht.
am mittwoch wird vom zimmermann ein zwischenboden in meinem atelier in form einer empore eingezogen, notwendig gemacht wegen der nicht endenden bücherflut. es geht zentral wieder darum, platz zu schaffen fürs eigene tun, das eigene archiv zu überwinden, so zu tun, als wäre alles noch zu leisten.
ich freue mich, sie persönlich und „leibhaftig“ kennenzulernen, wenn sie am 6ten sept. zu gast im literaturhaus liechtenstein sein werden.
ich wünsche ihnen weiterhin muse, energie und mut für all ihre projekte, insbesondere für das buchstabieren ihrer stadt in ihren düften und gelegentlich bestimmt auch dornen.
sehr verbunden, ihr hajqu
Weiler, Samstag, den 20.6.2020
Lieber Hajqu,
der Juni geht allmählich zu Ende. Die Bäume stehen im großen Grün. Es ist kühl und feucht, ob noch der Sommer kommt? Dieser Klang des Regens, der schäumende Bach trägt viel Wasser. Am Ende der Hausbachschlucht drehte man, wie man mir erzählte, in den 50ern, „Hans im Glück“. Das alte Märchenbuch liegt seit langer Zeit aufgeschlagen da, als wolle es mir diese Geschichte immer wieder von neuem erzählen.
Auf dem Markt gibt es den letzten Spargel, die letzten geernteten Erdbeeren.
Wir können wieder über die Grenzen reisen ohne Bewilligung, über der Grenze brauchen wir keine Masken mehr. Wir können Besuch empfangen. Die Schule beginnt.
Es sind sehr einfache Dinge der Wahrnehmung. Doch was ist Leben? Die Glocken läuten. Ich denke über das Wort Schellen nach, zerschellen, schellen, läuten. Was bewirkt das Läuten der Glocke? Es gibt dazu eine Geschichte vom Gespräch zwischen Himmel und Erde.
Der Kernbeißer sitzt seit einigen Tagen immer wieder an meinem Fenster und schaut neugierig in mein Zimmer. Sein Blick erinnert mich an das kurze Flötenstück in a-moll von Hans Keuning, an die ersten Sprechversuche, eine Volksweise aufnehmend, an Vogelgezwitscher: da, da, a b b a,
ich bin da, du bist da…
bei Y. Bonnefoy heißt es einmal über Poesie treffend: „Das Gestrüpp entfernen vom dem oder jenem Wort, zu dem man, zufällig, einen Zugang gefunden hat: wie man das Wasser erklingen hört unter dem Schutt und den hohen Kräutern, man kehrt dann zurück dorthin, und legt eine Quelle frei.“ Dafür doch existiert das, das man Kunst nennt?
Sie beschrieben sie als große, not-wendige Möglichkeitsform und Verwandlerin, als leise trotzende Kraft. Ich meine aber, sie kann auch das Gegenteil davon sein, zerstörerisch und entwürdigend.
Raoul Eisele, ein junger Dichter, schrieb so berührend an uns beide zu unserem Briefwechsel, zur Flaschenpost, wie Sie ihn nennen,
dass es nicht die Worte allein waren, sondern auch
die geteilte Einsamkeit von Inspiration und Mitgefühl begleitet.
In seinem Text an uns lese ich
alle sieben Sekunden hörte ich das Mondlicht, hörte es über schwarzes Glas spazieren…
das kurze eifrige Schlagen der Flügel
wo man wie leise einem Vogel die Hand hinhielt, mit den wenigen Körnern vom Boden,
ausgelotet, schweigendurchbrochen, die geliehene Landschaft
wie aus Wolken gehimmelt, aus heiterem Himmel
schneeweiße Pollen… und erst mit deinem Niesen, die Stille, dein Niesen das Schweigen durchbrach und ich dir sagen konnte: pass auf dich auf.
In diesen alltäglich nichtalltäglichen Tagen finden wir neue Formen des Zusammenseins, des Gesprächs.
Heute fand ich in der ZEIT die Todesanzeige von Alfred Kolleritsch mit seinem Gedicht:
„Es spricht mit uns,
dunkel und licht zugleich
Unvergängliches ohne Dauer.“ Alfred Kolleritsch (16.2.1931-29.5.2020)
„Anrufungen, worin der Angerufene außer Reichweite ist, worin er, selbst wenn er beschimpft wird, respektiert ist, selbst wenn er aufgefordert wird zu schweigen, in die Präsenz des Sprechens gerufen und nicht auf das reduziert ist…weil ich ihn, den Unbekannten bitte, sich mir zuzuwenden und als Fremder mich zu hören…
dass es sich nicht um irgendeine Sprache handelt, sondern allein um jenes Sprechen, worin ich in ein Verhältnis zum Anderen eintrete.“ M. Blanchot, Das Unzerstörbare Auch in einer „Flaschenpost“.
Es sind viele Dinge, die mich zurzeit berühren, anrühren, zum einen vermeide ich die Informationsflut, meide ich die Medien und doch kommen mir Nachrichten ins Haus, wie “die Lunge ist das neue Herz“, die Frage nach dem Sinn einer Corona App, weitere Öffnungen und Verhaltensweisen, es kann wieder geprobt werden in den Orchestern, neue Infektionsfälle.
Meine Tage und Nächte sind ausgefüllt mit Verrichtungen, Telefonaten und Mails.
Ich sehe ein Foto in einer Zeitschrift, das mich aufhorchen lässt: die blauleuchtenden Chorfenster der Heilig-Kreuz-Kirche in München-Giesing, lese, dass dort 12 000 Glasscheiben eingesetzt wurden, die aus Röntgen-Lungenaufnahmen entstanden sind, überwiegend von Gesunden, zum Teil von Kranken. Auch Teile des Rückgrats und der Schulter sind zu erkennen, wie zu einem Kreuz geformt. Ich erinnere mich des Besuchs vor Jahren auf der „Schatzalp“ in Davos, Thomas Manns Zauberberg. Aus dem Röntgenraum wurde eine Bar, die Originalliegen für die Lungenkranken gibt es noch. Mit Schlitten wurden die Toten den Berg hinuntergebracht. Ich erinnere mich noch an jenes besondere Ereignis, inmitten des Juni fiel Schnee über Nacht auf die blühenden Lupinen und Bergwiesen, wie eine stille Verheißung.
Ich lese Pressenotizen zu Christos Tod. Ich begreife plötzlich, was „Augenöffner“ sind, dass etwas Bedeutung hat, was über das Augenscheinliche hinaus geht, hinaus reicht, dass etwas hinter der Wirklichkeit ist, was wir mit anderen Augen sehen lernen müssen.
Steckt dies nicht auch hinter jenem alten Spiel des Verhüllens, das Gespür für das Geheimnis, etwas Verheißungsvolles könnte auf uns warten, wartet auf uns?
Erfahren wir da ein existenzielles Berührtsein und zugleich jenen Anruf: „Du musst dein Leben ändern?“ (Rilke) Lernen wir, hinter den Vorhang zu schauen?
Da treffen mich Wortfetzen im zufälligen Gespräch mit Freunden: „Bachmannpreis 2020, Klagenfurt, Helga Schubert, „Vom Aufstehen“, Eine Geschichte über das Leben und Sterben der Mutter.
Vor einigen Jahren war ich Zuhörerin, es waren heiße Junitage, Kühlung und Gelassenheit suchten wir im Wörthersee und in Mahlers Komponierhäusel. Noch immer spüre ich eine leichte Verstimmung, Klagenfurt damals in festliche Stimmung getaucht, dann jener eiskalte Seziersaal, draußen die Hitze, drinnen die Honoratoren, Vertreter der Öffentlichkeit und die Sezierkunst in allen menschlichen Facetten und heiteres, geselliges Beisammensein draußen. Und nun 2020 Bachmannpreis online.
Plötzlich werde ich wach, sehe das kurze Selbstporträt von Helga Schubert, stutze, der Sprachduktus, ich denke an Christa Wolf, an Sarah Kirsch, den KinderBuchVerlag. Da ist die Spur.
Unaufgeregt, ganz bei sich und authentisch spricht Helga Schubert in ihrem Garten und in dem bleibt sie auch zu Corona-Zeiten. Ich wünsche unwillkürlich Helga Schubert den Bachmannpreis 2020. „Es könnten doch ihre Enkel und Kinder sein, die da mit dabei sind beim Wettlesen am Wörthersee“, sagt sie. Eine eigentümliche Wärme überkommt mich, als ich sie in ihrem Kurzfilm zur Pferdeweide gehen sehe, weit weg von Klagenfurt, die Kritiker in ihren Häusern und sie an einem Tisch auf der Wiese sitzend, ihren Text vortragend.
„Vom Aufstehen“ heißt ihr Text, ja, „Vom Aufstehen“. Ich finde, was ich suche, den Katalog vom KinderBuchVerlag Berlin 1993, da stehen wir beide, sie auf Seite 15“ in der ABC Reihe mit „Bimmi vom hohen Haus“, ich auf Seite 14 mit „Ich bin ich und wer bist du?“.
Da ist der Duft des Rosenöls, die Lektüre von Sartre, die drei Dinge ihrer Mutter, die sie leben lassen, „Salomonis Seide“, Paul Gerhardt, unser gemeinsames Kinderabendgebet, das Kinderlied, das ABC des Erinnerns, sie dort, ich hier.
„Alles auf der Welt existiert, um in ein Buch zu münden“, sagt Mallarmè, in jenes Buch des Lebens.
Ich ertappe mich dabei, dass ich in diesem Monat noch das lang angelegte Wörterbuch, das Buchstabieren meiner Stadt, mit ihren Düften, Ängsten und Erinnerungen beenden wollte und finde das Gedicht der verstorbenen Dichterfreundin Viola Fischerovà als Vorspruch:
Ist das
noch ein leerer Friedhof?
Oder ein Apfelgarten
von einer Mauer umgeben
Ein Friedhof im Herbst
mit Reihen von Apfelbäumen
Und die Früchte auf den Ästen
haben sie für die Vögel gelassen?
Viola Fischerovà
Was der Wörthersee doch alles zu bewirken vermag. Ich drück Helga Schubert die Daumen. Heute ist ja noch Samstag. Ich werde schon noch auf irgendeine Weise erfahren, ob sie ihn bekommen hat, den Bachmannpreis 2020. Ich freue mich, Helga Schubert wieder begegnet zu sein und das in diesen Tagen.
Herzlich grüß‘ ich Sie,
Antonie
10. – 12. Juni 2020
liebe antonie,
naiv beobachte ich: wenn läuse im holder überhandnehmen, kommen früher oder später marienkäfer und holen sich die läuse. ich neige dazu, an ein prinzip der resilienz zu glauben. widerstand, der zuerst abseitig aufflackert und sich mit zunehmender unwiderstehlichkeit luft verschafft. die zwei sätze «i can’t breathe» und «i want you to panic» haben sich einem tief ins herz eingebrannt. der mord an george floyd war def. einer zuviel: die bürgerrechtsbewegung «black lives matter» gegen rassismus und polizeiwillkür in den USA wird sich durch keine «law and order»-doktrin unterdrücken oder aufhalten lassen. die wucht der strasse tut das übrige. der kniefall ist zu einer geste des protestes geworden. – die niederträchtige politik von trump, bolsonaro & konsorten, die sich trotz virulenter krise hemmungslos um nichts anderes als den eigenen machterhalt kümmern, wird bald ein ende haben. diese hoffnung hege ich. die pandemie nehm ich gleichzeitig wahr als die unerbittliche, selbstverschuldete nemesis für das, was dem planeten im anthropozän zugemutet wurde. noch verschlimmert die eklatante unfähigkeit der entbehrlichen demagogen die lage. die zwei sätze jedoch pochen auf veränderung und entscheidung. der kippzustand ist erreicht. wir werden sehen.
«il faut cultiver notre jardin». was bleibt uns anderes, als den eigenen garten zu bestellen? resilienz zu üben? phantasie zuzulassen? sich um die elementare flamme zu kümmern, gegenstrategien zu kultivieren? ich frage, was vermag kunst auszurichten? in welcher reichweite? wo ansetzen? – wenn kunst anderes sein will als ein blosser kommentar. mit der vergeblichkeit von kunst zu kokettieren, kommt mir nicht im traum in den sinn. den verlorenen posten gibt es nicht. für wen wäre kunst vergeblich? im gegenteil, al rovescio, sie hat mit bewohnbar- oder urbarmachung zu tun.– ich betrachte sie als grosse, notwendige möglichkeitsform + verwandlerin, als leise trotzende gegenkraft zur gravität des faktischen, als opposition und dezidierte dissidenz, freilich mit andern mitteln. sie „operiert“ als zauberkunst im umfassenden sinn, sie legt hand an, sie verwandelt, was sie berührt, flickt am zerrissenen tuch des humanen, stopft nicht bloss löcher, sondern öffnet subtile gegenwelten, erzeugt con ostinato rigore selbst noch unter dem vorwand der reparatur verheissungsvolle sinnbilder. gerhard meier fand den paradoxen satz: «kunst ist auf einem schwarzen schimmel zu reiten».
ich beobachte den regen und verscheuche mir die schafskälte mit lektüre: «nicht müde werden, sondern dem wunder, leise, wie einem vogel die hand hinhalten» (hilde domin). lesen als vergewisserung des eigenen stands. zum beispiel die gedichte von marion poschmann: wie sie es anstellt in der «geliehenen landschaft», im untertitel als «lehrgedichte und elegien» bezeichnet, in leichtem anflug, aufgewühlter in «nimbus», ihrem jüngsten lyrikband, gletscherschwund + artensterben als innewohnenden klimawandel auszuloten. in selbstinklusion, ohne dringlichkeitsappelle. sie tut es mit bedacht, genau, in der radikalität und stillen insistenz von lyrik. poesie, von der johann georg hamann in seiner «aestetica in nuce» souverän behauptet: «Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie der Gartenbau, älter als der Acker: Malerey, – als Schrift: Gesang, – als Deklamation: Gleichnisse, – als Schlüsse: Tausch, – als Handel». marion poschmann zitiert diese passage vor dem gedichtzyklus «Bernsteinpark Kaliningrad».
wir begannen unser gespräch mit blühenden birnbäumen. das gespräch über bäume ist wieder möglich, auch wenn uns bald anderes blühen dürfte. es fällt einem schwer, von keinem verschwinden zu berichten. die schwindenden ereignisse begleiten einen auf schritt und tritt. man kann es nicht einmal mehr als begleiterscheinung des älterwerdens beschwichtigen. die zäsuren sind da, ereignen sich in tagtäglicher beobachtung. es ist nicht gesagt und jedenfalls keine selbstverständlichkeit, wenn sich raupen noch verpuppen. der boskop in der hausbündt, der uns letztes jahr mit einer unerhörten fülle von äpfeln beschenkte, lässt heuer aus. er hatte kaum blüten. kunststück, wir haben ihm einen februar-schnitt verpasst. nun, der baum wird sich hoffentlich erholen und zu erneutem (biennalen) wurf ausholen, davon möchte ich ausgehen.
gestern, an fronleichnam, – in der kindheit gabs an diesem landläufigen feiertag die schier endlose prozession auf die felder, wo (fast) jedes feldkreuz gesegnet wurde – was am ende belohnt wurde durch das verteilen eines knusprigen „püürles“ der bäckerei lingg in schaan – , gestern also, haben wir eine ausfahrt nach appenzell unternommen, haben in der «ziegelhütte» die ausstellung von EMMA KUNZ besucht. appenzell, eine abgründig-idyllische gegend, eine landschaft kreisender linien, die immer wieder unvermutet in tobeln mündet.
ein zugänglich, unzugänglicher kanton mit archaischen bräuchen wie dem silvesterchlausen und kauzigem dialekt. durch die tiefliegenden wolken fletschte gelegentlich der alpstein.
ein wort zu emma kunz, die zu lebzeiten als heilprakterin bekannt wurde: sie pendelte und entdeckte das heilgestein des würenloser römersteinbruchs. ihre grossformatigen „kraftfeld“zeichnungen auf millimeterpapier sind eine eigenartige posthume entdeckung, blätter, die sie niemandem zeigte. emma kunz verstand diese arbeit als eigentliche feldforschung, die sie obsessiv betrieb. zu kunst wurden diese zeichnungen posthum von kuntkritikern deklariert. nicht zu unrecht. aber über den status dieser zeichnungen, die in geometrischer form von menschbeherrschenden, bestimmenden kräften, figuren und polaritäten zeugnis ablegen, über diesen status lässt sich trefflich raisonnieren. fraglos sind sie eine kapitale entdeckung. es war kein zufall und ebenso instruktiv wie witzig zu beobachten, wie mir erzählt wurde, als während einer der ersten ausstellung dieser feldzeichnungen von emma kunz im dez. jänner 1975/1976 im CENTRUM FÜR KUNST UND KOMMUNIKATION (CCC) in vaduz, bauern vom grabser berg mit gewundenen villiger-stumpen und mit rucksäcken in die avantgarde-galerie wundern und schnuppern kamen: diese leute kannten emma kunz nur von ihrer heilpraxis …
sie erwähnten gerhart baumann als lehrer ihres leider verstorbenen mannes, sprachen von dessen leuchtenden erinnerungen an celans legendäre lesung am 24. 7. 1967 im audimax von freiburg in gegenwart von martin heidegger. wenige tage später entstand celans gedicht TODTNAUBERG, das von der enttäuschenden begegnung zwischen heidegger und celan spricht, das von einem verfehlten gespräch handelt. der philosoph vermied bei ihrem treffen auf der hütte von todtnauberg ein klärendes, persönliches wort an celan. der philosoph wich aus, als der dichter ihn auf seine naziverstrickung ansprach. heidegger hatte sich öffentlich nie davon distanziert, er blieb unnachgiebig. die schmerzhafte ambivalenz des gegenseitigen verhältnisses wurde umso deutlicher: celan und heidegger lasen einander, aber ihr persönliches verhältnis blieb unnahbar und papieren. ich weiss nicht, ob celan je sein gedicht TODTNAUBERG öffentlich las. es ist im jänner 1968 als exquisiter „primdruck“ in der edition brunidor, paris, herausgegeben von robert altmann, in einer auflage von 50 exemplaren erschienen. die edition kam nie in den handel, wurde unter freunden und einige bibliotheken verteilt. celan sandte heidegger ein exemplar zu. celan zitiert im brief vom 2.2. 1968 – lichtmess bei uns – an robert altmann die zentralen sätze aus heideggers brief vom 30. Januar an celan, wie der philosoph auf den erhalt der sendung von TODTNAUBERG reagierte: «Das Wort des Dichters, das ‚Todtnauberg‘ sagt, Ort und Landschaft nennt, wo ein Denken den Schritt zurück ins Geringe versuchte – das Wort des Dichters, das Ermunterung und Mahnung zugleich ist und das Andenken an einen vielfältig gestimmten Tag im Schwarzwald aufbewahrt. [……] Seitdem haben wir Vieles einander zugeschwiegen.
Ich denke, daß einiges noch eines Tages im Gespräch aus dem Ungesprochenen gelöst wird.»
die schlichte und kostbare edition von TODTNAUBERG hat briefcharakter. robert altmann, mit dem mich eine nachhaltige freundschaft verband, schenkte mir im tausch gegen eine eigene arbeit ein exemplar davon, die nummer 33, signiert vom dichter.
ich war leider zu jung, um celans lesung am 10. aug. 1968 in vaduz mitzubekommen. damals steckte celan, wie er franz wurm schrieb, in seiner „zweitbesten haut“. was wir von robert altmann persönlich erfuhren: celan war den ganzen tag verschwunden, bis zuletzt blieb unklar, ob er überhaupt zur lesung erscheinen würde. für den gastgeber robert altmann war celans aufenthalt in liechtenstein desavouierend bis heikel, ein eigentlicher eiertanz. aber lassen wir das.
…
schön zu erfahren, dass sie einen imker in der nachbarschaft haben, der sie mit honig versorgen wird. ich bewundere leute, die etwas vom imkern verstehen.
passion dafür scheint mir die grundvoraussetzung. – überhaupt, alles von wert, hat wohl diese grundvoraussetzung.
– ich bin erleichtert, dass ich meine gouachen gemalt habe. Ich sende ihnen gelegentlich eine aufnahme davon. – die edition von «der mann in der blüte» beschäftigt mich nach wie vor. ich arbeite am entwurf weiter.
Ich grüsse sie herzlich bei föhnsträhnig mildem tag hinaus ins allgäu.
ob der föhn soweit reicht?
herzlich, ihr hajqu
Weiler im Allgäu, den 4.6. 2020 nach Pfingsten
Lieber Hansjörg,
sollten wir nicht Voltaires Worte befolgen?
…il faut cultiver notre jardin“,
heute Morgen riefen die Wildtauben früh, es ist kühl, ebenso die Farbigkeit der Landschaft in ein fremdes Grün getaucht.
Auffahrt und Pfingsten sind vorüber. Pfingsten – früher mit dem weißen Blütenwehen und jetzt schon die Pfingstrosen verblüht!
„Es wird nie mehr so sein wie vordem…“, ist zu lesen, zu hören.
Natürlich wird es nie mehr so sein! Trotzdem mahnt mich die Trockenheit auch hier im Allgäu, der Verlust der Vogelarten, der Insekten…
Wohin gehen wir mit unseren täglichen Entscheiden? Wohin wollen wir gehen?
Läuse find ich zuhauf an den Rosen, ein toter, auf dem Rücken liegender Maikäfer auf dem Gartentisch, der erste den ich wiedersah nach Jahren, der aufgebrochene Wolkenhimmel über den Hügeln, pastos, zerbrechlich wie der Anschlag der Tasten auf dem Cembalo. Wird Regen kommen?
Wird wieder eine sogenannte Normalität sein? Öffnet sie uns die Tür und tritt sie ein?
In der Tageszeitung sind heute Joe Bidens Worte abgedruckt, als er die Schutzmaske vom Gesicht nimmt und in die Kameras blickt: „Ich kann nicht atmen“. Die letzten Worte George Floyds. Wie ein Echo treffen sie ins Herz!
Ich denke an Hölderlin und Celans Worte:
„Und was du hast, ist Athem zu holen.“
„Atem, das heisst Richtung und Schicksal.“
Umso mehr ist da dieser Drang, den Ort zu wechseln, in Kommunikation zu treten mit etwas, das Hoffnung verheißt.
Damit das Viele uns nicht mehr erdrückt, der unhörbare Ruf der Taube hörbar wird und das Verstummen der Vogelrufe endet…
Alles hat seine Zeit, sagt Kohelet.
Und wie ein Echo erscheint mir Heideggers Randbemerkung zu Celan:
„Warum nicht endlich sagen, Wirklichkeit will gesucht und genommen sein.“
Es kommt Licht ins Wolkengetümmel, das Grau weicht dem Himmelsblau.
Sie schrieben „white matter: white matters!
Dann die „Augenweiden“ Ihrer Landschaft mit den Magerwiesen, den intakten Bergdörfern, dem Heuduft, den alten, erhabenen Sakralbauten, den Steinmauern, wanderten mit Ihrer Büchergabe auf den weißen Gartentisch und eröffnen mir Ihr Tun in dem Namen Eupalinos und Ihre Freundschaftskultur, die mir auch in dem wunderbaren Film von Bruno Monguzzi lebendig wird. Ich holte die Bücher Hans Brockhages hervor. Wir lernten uns kurz nach der Wende kennen.
Sie schrieben, wer im Sichtbaren arbeitet, muss sich seiner Mittel bewusst sein, und setzten dazu Koroliovs Spiel in Verbindung und ich Brockhages Worte, dass ein Stück Holz
vor allem eine Idee ist, ein Ruf sein kann – ein Rezitativ:
„Es kann vom „Lied der Hirsche“ erzählen – von dichten Wolken, die den Raum durchqueren und ihm widerstehen.
Eine Kraft sein, unnachgiebig wie eine Form, ein Ding, ein Ziel.
Ein Ziel oder das Zielen. Wie ein Bogenschütze – um ins Schwarze zu treffen.
Man muss lange sein Material herausgefordert haben – vertraut sein den Schnitten und Netzwerken, den Formen und Rhythmen der Natur, sagt er.
Geschieht dies nicht auf ähnliche Weise in jeglicher Kunst, und erfahren wir dabei, dieses Eintreten in die Zeit diesseits der Zeit, wie Blanchot sagt? In den Ur-sprung?
Wie geht es Ihren Projekten? Konnten Sie das „Herzblut“ spenden und die Edition fertigstellen zum „Mann in der Blüte“?
Ihrem Altmann Projekt Quaderno III, das ich wie verzaubert am Pfingstmontag las, wollte ich noch eine persönliche Notiz hinzufügen. Gerhart Baumann war der Lehrer meines verstorbenen Mannes. Er erzählte mir des Öfteren von jener legendären Lesung Celans im Auditorium maximum am 24.7.1967.
Sind es nicht doch immer auch die Orte, wo man niemals ganz dort ist? Vielmehr an mehreren Orten zugleich, und malt sich der Mensch von diesen verschiedenen Orten nicht ein Bild oder zeichnet er nicht auch eine Landkarte, in der er wohnen kann? Marbacher Magazin /2001
Nun ist die Schafskälte da, nicht nur die äußere, auch die innere. All die Geschehnisse sind da, die man nicht fassen und fühlen kann.
Die Grenzen öffnen sich heute zu Italien hin, Grenzen sind sehr sensibel, wenn man sie zur Unzeit übertritt, wie den Gartenzaun, dann spürt man jene Zerrissenheit bis hinein ins Körperliche.
Der Regen ist gekommen, der angekündigte.
Auf dem Garagendach meines Nachbarn sind seit heute Bienenstöcke aufgestellt. Er gesteht mir seine Leidenschaft zu Bienen. „Nächstes Jahr, vielleicht, gibt es Honig“, sagt er, „die Bienen sind jetzt noch zu jung, nächstes Jahr!“ Und eine Freundin bringt mir noch gegen Abend ein Glas Honig vorbei, ebenfalls von einer Freundin, die Imkerin ist.
„In diesen Zeiten brauchen wir doch allen Honig, wir alle!“, sagt sie und lächelt.
Über die geöffneten Grenzen hinaus,
grüß ich hoffnungsvoll hinüber nach Schaan,
Antonie
Schaan, 23. Mai 2020
liebe antonie
mit «primavera» entwerfen sie ein primaveristisches programm:
ein blühen, zittern und balancieren. von worten ausgehen, sie kindergleich kosten, mit worten schlendern, taumeln, kreiseln, beiläufig den eigenen schwerpunkt finden.
ein innehalten, ein grosszügiges, notwendiges innehalten in der & wider die pandemie.
sie sprechen mir aus der seele. das leben, so sagte es ein freund, ist eine kunst der begegnung.
das stimmt – ich würde sagen – vorbehaltlos. es setzt ein angesprochensein voraus. genau und tiefenscharf wie der satz von dietmar kamper, den sie mir aufgeschrieben haben, ein geheimnis nennt. ein satz, eine gleichung fast von geometrischer strenge, unauslotbar, vielleicht von der paradoxen wendung/windung einer möbius-schleife. das tröstliche des versuchs: der gegenstand der kunst bleibt unnennbar und flüchtig, im geheimniszustand.
ein geheimniszustand, wovon inger christensen eine ahnung vermittelt im essay «die seide, der raum, die sprache, das herz». ein essay, den man zirkulär zu lesen beginnt, wieder und wieder, einer zirkularatmung gleich. einen gedankenraum, den man zirkulär ein- und ausatmet,
der einen verwandelt.
es ist eigenartig. vieles, woran ich arbeite, erscheint mir als ein „retour à l’ordre“, als eine rückbesinnung auf eine grundgestimmtheit. an welche innere ordnung, an welche stimme soll man sich wenden? die inneren affinitäten kommen einem zuhilfe in der diffizilen phase des findens.
wer im sichtbaren arbeitet, muss sich seiner mittel bewusst sein. koroliovs spiel traf mich in seiner porösität. er stellt ein prinzip unter beweis: es genügt nicht, den bauplan einer partitur zu kennen,
sondern das entscheidende liegt darin, den inneren raum im zuhörer erfahrbar zu machen, zu erschliessen, was gilt. sein instrumentarium aus- und inwendig kennen.
es sind fraglos die meister, die einen leiten und begleiten, die einem herz und sinne öffnen.
diese erfahrung mache ich jetzt, heute, bei den grafischen arbeiten von bruno monguzzi, aufmerksam geworden durch einen NZZ-artikel.
die arbeiten von monguzzi erklären sich selbst in ihrer poetischen wucht, er ist ein kopf- und handarbeiter von rang. seine plakate sind und wirken so, als ob eine agile, sichere und souveräne hand, die details an die richtige stelle rückt. monguzzi hat eine ahnung. ich vertraue seiner stimme, folge seinem instinkt. im bemerkenswerten film von heinz bütler zur arbeit von bruno monguzzi, (zu sehen unter https://vimeo.com/394134905/d2c9c7c1d7) lässt er den gestalter anhand eigener arbeiten von seinem arbeitsprozess sprechen, von seiner recherche, seiner methodik, rezeptlos. er spricht von innerstem wissen. ich finde das fesselnd. künstler sprechen nur vor ihrer arbeit gut.
verzeihen sie die abschweifung.
2 dinge, 2 hausarbeiten stehen an: ein solidaritätsbeitrag für das hilfsprojekt eines indonesischen künstlers, der in liechtenstein lebt, der ein bambus-aufforstungsprojekt auf java initiiert. dafür möchte ich herzblut spenden in form von drei gouachen, die ich in gedanken
längst entworfen habe, die aber noch nicht gemalt sind. dann beschäftigt mich die edition eines textes einer befreundeten schriftstellerin zu einem bild ihres mannes, «der mann in der blüte», die einer besonderen feinabstimmung bedarf. ich arbeite mit einem buchdrucker und buchbinder in personalunion zusammen, der meinen anspruch kennt. das bestimmen von schrift, die wahl von papier, die anmutung des druckwerks verlangt fingerspitzengefühl und treffsicherheit in der manufaktur. ich komme der sache allmählich näher.
das brauch ich ihnen nicht weiter zu erläutern. sie kennen und bewegen sich in dem metier.
sie werden mir vielleicht einmal erzählen, wie sich die zusammenarbeit mit ihrer illustratorin isabel pin ergab, wie sich sich gefunden haben. ihr gemeinsames buch «kleiner könig, wer bist du?» stellt einen grossartigen „wurf“ dar.
zu beobachen, wie sich affinitäten ereignen, ist eine erhellende erfahrung: alle entfernungen sind im nu überwunden. auch davon legen sie zeugnis ab in ihrem inneren gedankenstrom mit der chinesischen komponistin cong wei. wahlverwandschaft, wenn sich gedankenräume berühren und zu einem kreisendem gespräch entfalten, bedeutet ihnen wie mir ein rares geschenk.
ich empfinde in diesem zusammenhang tatsächlich das verbindliche continuum der farbe weiss als balsamisch: WEISS, «die farbe der stille», verstanden als die summe aller farben, als resonanzraum aller farben, die sie zum klingen bringt.
white matter: white matters!
beim morsezeichen dachte ich gleich an den ruf des kuckucks, den ich vor einer woche im ruggeller riet wiederhörte. wie kann man diesen ruf vergessen, den man nicht zu orten vermag.
kaum zu fassen, ist der ruf dieses «schelms», der einen aufhorchen lässt und ins sinnen bringt,
wie ein echolot im all.
ich grüsse sie herzlich über den bodensee hinaus.
herzlich, hansjörg
Weiler im Allgäu, den 17. Mai 2020
Lieber Hansjörg
„Zu hören wie das Leuchten von blühenden Eichkätzchen am Wegrand“,
schrieben Sie, hellhörig zu hören am Wegrand wie … von blühenden Eichkätzchen das Leuchten zu hören …Ich spiele damit, wie ein Kind seinen Vers aufsagt, langsam, schneller, Wörter entlässt, springt.
Ich höre es, das Leuchten aus den „wenigen Geräuschen“.
Und dann bezaubert mich dieses Wort „primavera“, Frühling mit der ersten Wahrheit, dem ersten wahr sein, gewahr sein in den Tagen der Pandemie, ein Rätselwort im Widerhall, ein Sehnsuchtswort.
Gestern mailte mir ein alter Freund auf meine Bitte hin, Dietmar Kampers Zitat, das ich Ihnen nicht vorenthalten will in seiner Präzision, jene Erfahrung des Raums, die Sie kennen.
„So wie der Raum Götter, Menschen und Dinge trennt, so verbindet sie die Zeit. Sein Wesen ist die Grenze, ihre Wahrheit ist der Augenblick“. Dietmar Kamper, Zur Soziologie der Einbildungskraft, Carl Hanser Verlag, München/Wien 1986, p.124.
Diesen Augenblick, das gegenseitige sich Erkennen von Künstler und Werk ahne ich als Geschehen in Ihrem Arbeitsraum, aber auch als Köstlichkeit der unvermuteten, unerwarteten Begegnung in Ihrem letzten Brief.
Beethoven, sagte der Freund im gestrigen Gespräch, begleite ihn nun neben Mozart täglich und Hyperion seit seiner Jugend und er fügte noch hinzu, dass der Mensch sterben müsse, weil er den Anfang und das Ende nicht zusammenbringen könne. Wenn wir nur schrieben, lebten aus dem Phänomen, um uns selbst zu sein, käme etwas zur Geburt, dass einen die Dinge anschauen…
Woran Sie wohl gerade arbeiten…
Ihr Nennen von Evgeni Koroliovs Bachinterpretation machte mich neugierig, ist es nicht diese schlichte Frömmigkeit, das Umsonst des Tuns, ausgerichtet auf etwas Größeres, dieses „soli deo gloria“, was uns bei Bach in Erstaunen versetzt und eine wunderbare Beglückung auszulösen vermag, dem Ankommen bei sich selbst in der Leichtigkeit und Tiefe des Seins.
Seit einem Jahr besitze ich ein Clavichord und Koroliov bestätigt mich in meinem Gefühl, dahin gehört Bach auch, in den kleinen privaten Raum.
Vielleicht gelingt es mir einmal, Bach und eigene kleine Kompositionen zu spielen, nur für mich.
Inger Christensens alfabet berührt mich zutiefst, als ob Sie gewusst hätten, dass Inger Christensen zu meinen Lieblingsdichterinnen gehört, sie weiß, dass das Gedichteschreiben immer auch wie das Stehen auf nacktem Boden ist…
Da Sie ganz spontan die Musik ins Spiel bringen, möchte ich Ihnen von einer jungen chinesischen Komponistin erzählen, die gerade in Hongkong festsitzt und sobald wie möglich wieder nach Deutschland ausreisen will. Vielleicht interessiert es Sie?
Ihr Brief kam dem Ihrigen zuvor. Ich glaube, dass es Gemeinsamkeiten gibt, trotz der räumlichen wie kulturellen Entfernung zwischen Ihnen und ihr und mir.
Wir hatten uns kennengelernt durch Prof. Robert H.P.Platz, der für die Abschlussarbeit seiner Studenten einen Text von mir auswählte: „Fastentage“, und der am 17.3.19 zur Uraufführung im Neumünster in Würzburg kam.
Seither schreiben wir uns. Natürlich auch über die gegenwärtig bedrängende Situation.
Cong Wei sandte mir ihre Soundcloud, damit ich einen besseren Einblick in ihr Werk bekäme.
BATHE MY SOUL IN THE FIRE
erschütterte mich zutiefst, den gewaltigen Klangraum, den diese zarte Person schuf an weltumfassendem Klagegesang.
Ich musst an A. Delps Worte denken: „Keiner durchschreitet die Glut ohne Verwandlung.“
BEAMS OF LIGHT IN THE DARKNESS
lösten Assoziationen aus in dem ergreifenden Gesang, Aufschrei der geschundenen Kreatur und Materie, wie der vom Brand gezeichneten Kathedrale Notre Dame, der nach Atem Ringenden…im hellen Klang der Glocken, ein stellvertretendes Wachen in den Flüchtlingslagern, Krankenhäusern, bei den Verzweifelten, Vereinsamten.
„Hören des Leuchtens“
In dem kleinen Band:
„Migranten“, das ein Gespräch zwischen Edmond Jabès, Massimo Cacciari und Luigi Nono wiedergibt, fand ich eine Stelle, die auszudrücken versucht, was nicht auszudrücken ist, was Musik und Sprache verbindet, jene Stille, jenes Leuchten, in die das Wort, die Musik letztlich heimkehren, rufend, singend, jedoch erwartet.
Es war, vielleicht nun schon vor einem Jahr. Bei mir die erste Begegnung mit einem Mann, der in sich die Stille von tausend nahen oder fernen Stimmen trug, die jedoch alle erwartet wurden.
Ist sie nicht weiß, die Farbe der Stille, die alle Farben miteinzuschließen vermag, wie Morsezeichen es vermögen bei Nacht, unsere Hoffnung leuchten zu lassen.
Nun ist es Nacht geworden, das Heu duftet, nach einem strahlenden Sommertag im Mai,
grüß ich hinüber nach Schaan, vielleicht steht der Orion am Himmel…wer weiß,
herzlich
Antonie
Blinder Orion
Schiffbrüchige sind wir
in der Ordnung des Lichts
Morsezeichen
Gesandte
in Eile
Von Insel zu Insel
Im entfesselten Frühlingswind.
Schaan, 12. Mai 2020
liebe Antonie
sie zaubern mit ihrem brief kammermusik in meinen arbeitsraum.
wohltemperiert und von feiner weite. sie lassen revue passieren, wie wir ins gespräch kamen, im bewusstsein, dass wir ein gespräch sind. lyrische stimmen begleiten uns. die «wenigen geräusche», die philippe jaccottet genügen, sind noch leiser geworden. zu hören wie das leuchten von blühenden eichkätzchen am wegrand.
«ist uns nur noch mit gedichten zu helfen?» fragen sie so entwaffnend, wie das nur kinderseelen vermögen. ich möchte mir helfen, das zu glauben. verhalten, mit dem unterton von «erkenne die lage, rechne mit deinen defekten».
es gehört fraglos innere noblesse dazu, eine form von selbstvergewisserung in gedichten auszuüben, die den bann der lage zu brechen versucht. ich bewundere das wagnis, das sie damit eingehen. in leichter sprache, die die schwerste ist. sie haben friederike mayröcker angerufen. wie in innerer anrufung. jemanden, der schon solange in nicht endendem schreibzustand, eine eminente dichterin, die sich in so vielfältigen étuden der aufmerksamkeit verschenkt: sich an gedichte zu verlieren, scheint mir die nachahmenswerteste kunst zu sein. die vornehmste art zu verschwinden und vielleicht im verschwinden zu bleiben. eine kunst, die sich gleichwohl von angeregtem ferngespräch alimentiert, ein drinnen und draussen herzaubert, mühelos. es genügen schon wenige worte.
das hellhörig werden auf details erzeugt so etwas wie eine lakonische trance. erzeugt einen zusammenklang, ausgelöst von beobachtungen im kleinen. man kann sich das aufsagen und aufzählen in hüpfender litanei bis sich ein fast unhörbarer oberton einstellt. eine wahrnehmung und weltbenennung mitunter wie in alfabet von inger christensen. selbstvergewisserung in der wortfindung auch hier.
fast beiläufig bin ich gestern auf die interpretation der goldberg-variationen von evgeni koroliov gestossen, die mich begeistern. da legt jemand so beredtes zeugnis ab vom inneren aufbau der dinge, in souveräner leichtigkeit, klar und hell. er hört das gesetz, oder macht es hörbar. nichts anderes als das, was nur musik von bach vermag. so selbstvergessen und herrlich, sodass fast pötzlich alles diffuse weicht, nichts mehr zu dämpfen vermag. es lüftet sich aller schleier. dieses momentum allein zählt, nährt und wärmt. – die äussere welt kann einem gestohlen bleiben mit ihren vielfältigen zumutungen …
ich lese aus ihrem brief, wie gedichte lebenselexier sind, zu sauerstoffreichen stellen werden, kleine exile, um sich zu begegnen. tomas transströmer hat, das muss ich sagen, eine unerhörte photosynthese mit worten geschaffen.
gelegentlich kommt ein wetterleuchten, das uns erhellt. der regen tröstet.
herzliche grüsse in alle weiler und gärten der poesie.
hajqu
Weiler im Allgäu, 8. Mai 2020
Lieber Hansjörg Quaderer,
im April klopften Sie bei mir an, im April, „dem schrecklichsten aller Monate“, wie ihn T.S. Eliot benannte.
Via Lichtgeschwindigkeit, via Mail vom Liechtensteiner Rheintal über den Bodensee ins unbekannte Westallgäu.
„Wie beginnen?“, fragte ich.
„Es ist gut zu fragen, wie beginnen?“, schrieben Sie.
„Zu fragen beginnen“.
„Wie einen Briefwechsel also anzetteln? Sorglos zu beginnen, wäre gut, nichts vorauszusetzen. Ein Schriftwechsel gleicht einem Wildwechsel…
zu lesen nämlich, wo einer gegangen“, schrieben Sie in Kleinschreibung.
So war ich versucht, in die Kleinschreibung meiner 70er Jahre zurückzukehren, beließ es aber dann bei einem Versuch.
„Sorglos zu beginnen“, schrieben Sie.
„Con sordino“, antworte ich,
„in diesen Tagen nur mit Dämpfer, gedämpft,
mit leisen Tönen wie beim Geigenspiel, auch im Erinnern.“
„Wo grad so vieles aus den Fugen“, sagten Sie: „Den blühenden Birnbaum zum Trost nehmen für die Zumutungen der Pandemie.“
Worauf hören? Auf „die wenigen Geräusche“? Auf diese kleine Hoffnung, die seilhüpfen würde in den Prozessionen…Péguy
Und auf das Geläut der Glocke am Morgen, wenn ich das Fenster öffne, den Gesang der Vögel zu hören. Es gibt da etwas, was mich erschrecken lässt, das bei großen Bränden manchmal auftritt, es ist diese Unerklärlichkeit der Stille, der Pausen, die mich verwirren und beglücken zugleich, wie das Gefühl vom Ende einer Welt, ohne die ich nicht mehr atmen könnte.
Trotzdem glaubt man an Worte im Vorübergehen, die ins Herz springen und sogleich verstummen.
Ist uns nur mit Gedichten noch zu helfen? So versuche ich es mit der Poesie, um die Welt um mich herum wieder zu verstehen.
Da schaue, höre ich Dinge, als hätte ich sie nie gekannt? Da stehe ich plötzlich inmitten einer Welt, angstvoll wie ein Kind und schreibe Kindergedichte.
Auf leisen Sohlen schleicht manchmal das Glück
über Stock und Stein, stolpert, strauchelt, stakst
und lässt sich nieder als kleine Feder auf deinem Bein.
Dieses Kindergedicht stammt aus meinem neuen Buch „Es flattert und singt, Gedichte und mehr und alles für Kinder“,
das erscheinen wird in diesem Herbst.
Heute Abend habe ich die Fahnen gelesen und mich gefreut wie ein Kind am Dichten zwischen Hahn und Henne im Hühnerstall inmitten der CoronaTage. Ist es nicht so? Wo das Unsichtbare sein Unwesen treibt, dichtet das Kind dagegen an, gegen die Dünnhäutigkeit, dem ‚Aussätzig Geworden Sein‘, dem Ausgesetzt-Sein der Sätze.
Wieder läuten die Glocken, rufen, als wollten sie mich in meiner stillen Verzweiflung trösten. Sie singen, sie dichten die Glocken, verbinden Himmel und Welt.
Heute sprach ich mit Friederike Mayröcker am Telefon und wir beschlossen, den Fuss in die Luft zu setzen, gemeinsam, dass sie trüge, war unsere Hoffnung mit Hilde Domin, die sie mag, wie das Gedicht,
ebenso jenes, das Angelika Kaufmann, die Freundin, schreibt, Tag für Tag, schon zum 80. Mal
immer und immer wieder auf ein neues Blatt.
zwei feuchte Lappen
Seele und Leib
Friederike Mayröcker
Ein bisserl schreibe sie noch gegen die Angst und bald, sagte FM, wenn der Spuk vorüber ist, treffen wir uns im Café Sperl.
Es liegt in der Luft, dieses Gedämpfte, Abstand halten, Tröpfchen, die uns Krankheit und Tod bringen können: verhalten die Stimme, das Lachen gedämpft … Wie wesentlich ist uns der Mund, das Wort – als hätte man es uns verboten?
Dabei umhüllt uns die Natur mit solcher Schönheit, mit solchem Blühen, einem unerwartet frühen Sommer, dem kreisenden Milan, dem Ruf der Amsel, mit duftendem Flieder, weißen und schwarzen Tulpen, Päonien, Akelei, Löwenzahn, Wiesenschaumkraut, Ehrenpreis… und immer doch der Gesang der Vögel am Morgen und diesem Blau und dem Wolkenspiel des Himmels.
Es wird gesagt, dass das „Herunterfahren“ der Natur gutgetan habe, dem Klima geholfen, die Verschmutzung reduziert, nur mit dieser rätselhaften Bedrohung kommen wir nicht zurecht, wie sollten wir auch? Wir haben genug von der Quarantäne und trotzdem sehne ich mich wieder nach einer Art Abgeschlossenheit, den Zimmerkonzerten, dem Bei-Sich-Sein, natürlich ist dies privilegiert…
Und dann ist da Europa, was ist dir, altem Europa? In der Übertragung des Europa Konzerts der Berliner Philharmonie mit Abstand und kleiner Besetzung, höre ich Musik, spüre etwas rätselhaft Gemeinsames, wir sind im gleichen Boot, bei den „Fratres“ von Arvo Pärt, bei Ligeti und Mahler überkommt mich für einen kurzen Moment dieses Gefühl der Verbundenheit, des Trostes. Wie ist es eine Stunde danach?
Zahlt es sich aus, dieses bedingungslose Grundeinkommen?
Ich denke an Aristoteles, der mich als Jugendliche so beeindruckte mit seiner Nikomachischen Ethik und an den biblischen Text vom Weinbergbesitzer. Was ist gerecht? Was gewährt ein gutes Leben?
Die Freiheit bleibt uns sowieso, etwas daraus zu machen oder auch nicht.
Was ist die Erde, die uns alle leben lässt, die wir ausbeuten?
Sind wir nicht alle nur Gewordene aus Geschenktem, Empfangenen, aus dieser rätselhaften Mahlzeit, dem 1:1 eingelösten Stoffwechsel?
Es wird nicht überall gejammert, Veränderungen werden konstatiert im alltäglichen Miteinander, wir erkennen uns hinter, unter der Maske, wir sind müde, vereinzelt, betroffen, haben uns eingerichtet oder auch nicht, sind verzweifelt, fühlen uns wohl.
Und heute, der 8. Mai, das Ende des 2. Weltkrieges, 75 Jahre danach.
Das „Lacrimosa“ im Essener Dom in Abstand und Nähe.
Was ist nur Leben? Und was Sterben?
Nichts mehr ist wie zuvor.
Ich höre das Plätschern des Brunnens, sehe den Mond, der aufgeht…
es gibt diese kleine Pause nach dem Regen, wo alles noch nass ist und doch
der Weg, die Straße trocken erscheint.
Heißt etwas begreifen, sich verwandeln? Und ich spreche leise:
zwei feuchte Lappen
Seele und Leib
zwei feuchte Lappen
Seele und Leib
und dann lese ich FM und mir zugleich diese Zeilen vor:
Zwei Wahrheiten nähern sich
einander.
Eine kommt von innen, eine kommt
von außen,
und so sie sich treffen, hat man eine
Chance,
sich selbst zu sehen.
Tomas Tranströmer
Es kommt Regen heute noch und während ich aus dem Fenster schaue, sind sie nahe, die Berge, zum Greifen nahe aus Österreich und der Schweiz,
herzlich grüsse ich hinüber nach Schaan
Waren da zwei Wahrheiten, die sich einander nähern,
Die eine kommt von innen, eine von aussen
und so sie sich treffen, hat man eine Chance,
sich selbst zu sehen?
Antonie Schneider
Schaan, 6. Mai 2020
liebe antonie schneider
wir haben in kurzer vorkorrespondenz verschiedene felder berührt.
die pandemie hat viele, insbesondere künstlerische freiberufler über das verschärfte prekariat hinaus in unmittelbare not gestürzt. die lohnarbeit ist weggebrochen.
zu sagen und zu tun gibt es immer. arbeit geht nicht aus, vieles gelingt sogar in grosser dringlichkeit besser. aber die lohnarbeit versiegt.
die arbeitsleistung lässt sich nicht mehr verdingen, bleibt einstweilen unvermittelbar, auch wortwörtlich, da keine bühne, keine plattform, kein öffentlicher raum zur verfügung steht.
die öffentlichkeit wurde bis auf weiteres reduziert bzw. plombiert:
machen „geisterspiele“ in imaginären treibhäusern oder zirkuszelten sinn?
anders betrachtet: die formen der wirksamkeiten verändern sich, bei virulenter vorhandenheit der eigenen person, der es immer weniger gelingt, lebensmittel zu produzieren.
man lebt nicht von luftwurzeln, lebt nicht vom verschieben, sondern von 1 : 1 eingelöstem stoffwechsel.
es verhält sich paradox. wenn die gering vorhandenen reserven aufgebraucht, zahlt sich trotz gesteigerter produktivität
die präsenz nicht mehr aus.
ausgesetzt, ‚aussätzig‘ geworden, kommt man ‚in die sätze‘; beginnt, weiter zu denken.
es schmerzt, dass leute in sog. risikoberufen unverschuldet in existenzielle not geraten sind.
aber welche berufe sind keine risikoberufe?
welchen ausweg gibt es?
keine(r) der freiberufler gibt sich mit staatlichen almosen zufrieden.
wann, wenn nicht jetzt ist die zeit reif für ein bedingungsloses grundeinkommen?
ich gestehe, sehr privilegiert zu sein: meine lebensmittel verdiene ich durch verschiedene (noch krisenfeste) projektarbeiten oder ‚parallelaktionen‘ als ‚funktionär‘,
sporadische einkünfte durch ein buchantiquariat. bin dankbar, dass es so ist.
nüchtern beobachte ich: quarantäne ist künstlern und autoren kein fremdwort, es ist schlichtweg die arbeitsbedingung im atelier.
sich isolieren, sich zurückziehen, sich aussetzen in den engsten, eigenen kreis, zu sich kommen, bei sich sein, ist die voraussetzung aller kunst.
«… geh mit der kunst in deine allereigenste enge. und setze dich frei.» schreibt paul celan.
die kunst der engführung lernt man nie genug. wie vertraut auch immer man mit den stimmen in der kunst der fuge.
kunststück: zurückgeworfen auf sich selbst, blättert einer in höchsten realisationen, liest, schaut und hört dinge,
die eine/r liebt, die einem notwendig, wie das atmen.
das kosten von lebenselexier, die sehnsucht nach dingen, die einem heilig sind.
die rückkoppelung zu dem, was eine/r als wesentlich erkennt.
das eintreten in einen strom von selbstvergessenheit.
sich einschreiben, der spur folgen, die man selber wird.
der satz von edmond jabès, den sie als zusatz am schluss eines briefes hinschrieben, klingt nach.
ich wiederhole ihn: «als ich, noch kind, zum ersten mal meinen namen schrieb, war mir bewusst, dass ich ein buch begann…»
dem beginnen in der beginnlosigkeit bewusst werden. das aufgreifen von fäden, nachdenken, denken, was bei paul valéry ‚den faden verlieren‘ heisst.
den knoten sehen, in den einer selber geknüpft, die schlaufe, die einen fasst, das gewebe in dem man hineinverwoben.
ich meine, man wird porös und wach, im dialekt heisst es bei uns ‚pluug‘, was dünnhäutig, fragil oder geschwächt bedeutet,
ein unübersetzbares wort.
über das unübersetzbare beginne ich nachzudenken und mich in gedanken zu verlieren.
ich grüsse sie herzlich ins allgäu, hansjörg quaderer
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von Literaturhaus Liechtenstein, Literaturhaus & Bibliothek Wyborada, dem SAAV und literatur.ist.