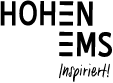Cara Roberta. Gabriele Bösch & Peter Gilgen

5. Oktober 2020
Liebe Gabriele,
mein letzter Brief an Dich ist lange her. Der Sommer, von dem wir einen sehr großen Teil in unserem Garten verbracht haben, war trotz des vielen Sonnenscheins eine melancholische Zeit: eine seltsame Zeit des Wartens, ich möchte fast sagen: des Ausharrens. Noch immer verbringen wir unsere Tage zuhause. Wir arbeiten hier, sitzen die meiste Zeit vor dem Bildschirm in Videokonferenzen oder bei anderen dringenden Geschäften. Unsere Besorgungen erledigten wir monatelang durch Bestellung über das Internet. Mittlerweile haben alle Supermärkte einen Abholservice eingerichtet. Man bestellt und bezahlt elektronisch und kann dann zum angezeigten Zeitpunkt die Einkäufe vor der Ladentür abholen. Man muss nicht einmal das Auto verlassen. Ein Angestellter packt die Waren in den Kofferraum, nachdem man sich per App identifiziert hat. Immerhin habe ich dadurch ein paar Fahrten durch Ithaca unternommen, für die es sonst keinen guten Grund gegeben hätte.
Wenn die melancholische Stimmung gar nicht mehr vergehen will, frage ich mich, worauf wir eigentlich warten. In der kommenden Woche sollen die Schulen in Ithaca wieder geöffnet werden. Zum ersten Mal seit März wird es wieder Präsenzunterricht geben, allerdings nur in reduzierten Gruppen – einerseits um die Ansteckungsgefahr zu verringern, andererseits weil viele Eltern den Fernunterricht am Internet für ihre Kinder für sicherer halten. Wir haben unseren Sohn Maurice im Kindergarten angemeldet, weil wir glauben, dass er andere Kinder um sich braucht. Es waren viele Monate, während derer uns nur ab und zu eine befreundete Familie mit einer Tochter, die ein Jahr älter ist als Maurice, am Wochenende in unserem Garten besuchte. Die Erwachsenen schützten sich mit Masken und hielten Abstand. Die Kinder tollten in ihren farbenfrohen Masken herum. Darauf waren Spiderman und andere Fabelwesen abgebildet, was die Beliebtheit des Maskentragens schlagartig in die Höhe schnellen ließ. Maurice freute sich meist schon den ganzen Vormittag, wenn er wusste, dass seine Freundin zum Spielen vorbeikommen würde. An den Wochentagen vermisste er den Kontakt mit anderen Kindern. Wir spielten, zeichneten, bastelten und malten mit ihm, wenn wir nicht gerade arbeiten mussten. Trotzdem fragte er oft nach seinen alten Freunden aus dem Kinderhort. Eine Familie schlug ein Zoom-Treffen zwischen den Kindern vor, aber Maurice hatte schon nach zwei Minuten genug vom Bildschirm und ging in sein Zimmer, um mit seinen Dinosauriern zu spielen. Während der letzten Wochen, als das Schuljahr offiziell schon im Gange war, wenn auch nur virtuell, hatten wir mit zwei griechischen Ehepaaren eine Kleingruppe organisiert – zwei Mädchen und unser Sohn – und dafür eine ganz wunderbare Studentin als Lehrerin engagiert. Alle Beteiligten ließen sich testen, bevor das Experiment begann. Einzig die Schulbehörde funkte ein wenig dazwischen, weil es viermal am Tag eine zwanzigminütige Internet-Lektion gab, die für alle Kinder obligatorisch war. Zur ersten dieser Lektionen sollten wir uns jeweils schon um 8 Uhr zuschalten. Danach gab es etwa alle 90 Minuten eine weitere. Ich weiß nicht, was sich die Erziehungsbehörden dabei gedacht haben. Für Familien mit zwei erwerbstätigen Eltern war dieses Arrangement alles andere als ideal. Umso besser, dass wir bereits unsere Lehrerin angeheuert hatten.
Am Montag beginnt der Kindergarten. Maurice freut sich darauf, vor allem auch weil eine seiner beiden Spielgefährtinnen, Zoe, der gleichen Klasse zugeteilt wurde. Die vom Staat New York vorgegebenen Bedingungen, unter denen die Schulen geöffnet bleiben dürfen, sind sehr restriktiv. Viele Eltern gehen davon aus, dass ein einziger größerer Corona-Ausbruch Grund genug wäre, den Präsenzunterricht für den Rest des Semesters abzusagen. Hängt damit das unangenehme Gefühl endlosen Wartens zusammen? Ist es die Gewissheit, dass es eine Rückkehr zum Leben vor Corona noch sehr lange nicht geben wird, die das Warten ziellos und dadurch umso bedrückender macht? Liegt es an dieser Ziellosigkeit, dass auch meine Projekte nicht recht vorangehen wollen, obwohl ich jede freie Stunde an ihnen arbeite? Kommt es mir darum so vor, als schlüge ich die ganze Zeit die Zeit tot?
Vor ein paar Tagen las ich Mark Strands Gedicht “After Our Planet,” das er 1992 in der Paris Review veröffentlicht hatte. Mitten in meiner Lektüre fragte ich mich, ob Strand wohl noch lebe. Es stellte sich heraus, dass er 2014 im Alter von achtzig Jahren gestorben war. Vielleicht hatte sich mir der Gedanke deshalb aufgedrängt, weil aus den strengen dreizeiligen Strophen von Strands Gedicht eine im Jenseitigen verortete, der Zeit nicht unterworfene Stimme spricht. Hier die erste Strophe:
I am writing from a place you have never been,
Where the trains don’t run, and planes
Don’t land, a place to the west,
–––a place to the west: Dieser Ort liegt im Westen – schon bei den Ägyptern die Himmelsrichtung des Todes. Für die Amerikaner liegt dort die frontier, die Grenze zwischen Zivilisation und roher Natur, die sich im Laufe der Geschichte immer weiter verschob: von den weiten Ebenen des Mittleren Westens über die Rockies bis nach Kalifornien und Oregon, wo sich dunkle Nadelwälder bis an den äußersten Rand des Landes vorschieben, das als Steilküste wie mit Gewalt abgebrochen jäh in die grauen Wellen des Pazifiks stürzt. Einst, bevor noch das Hier-und-Jetzt die jenseitigen Gegenden eroberte, gab es dort keine Eisenbahn. Kein lärmendes Flugzeug setzte zur Landung an. Die Mammutbäume blieben unter ihresgleichen, manche davon über hundert Meter hoch, die ältesten über 3000 Jahre alt.
Jetzt sind viele von ihnen verkohlt. Einige werden auch dieses Unglück überleben. Aus den verbrannten Stämmen werden bald grüne Schößlinge sprießen. Doch viele der alten Riesen sind verloren, Opfer der Waldbrände, die sich seit Wochen im Westen des Landes immer wieder entzünden und auch vor Siedlungen und Städten nicht haltmachen. Aus San Francisco schickten mir Bekannte in den letzten Wochen Bilder der Stadt, aufgenommen zur Mittagszeit. Straßen und Hochhäuser erscheinen verdunkelt in einem feurigen Schein. Der Himmel glüht orange. (So ähnlich muss es auf dem Mars aussehen, denke ich unwillkürlich). Man könne nicht aus dem Haus, schrieb mir eine Freundin, es habe zuviel Ruß und Asche in der Luft. Selbst mit Maske fange man zu husten an und könne kaum mehr atmen. T. C. Boyle, von dem Du in Deinem ersten Brief an mich schriebst, meinte sarkastisch, dass man jetzt Maske tragen müsse, wenn nicht wegen des Coronavirus, dann eben wegen der Waldbrände. Mittlerweile sind an der Westküste mehr als 20,000 Quadratkilometer abgebrannt (davon 16,000 in Kalifornien) – die halbe Schweiz oder ein Viertel von Österreich.
Die fire season ist noch längst nicht ausgestanden. Von den größten Flächenbränden, die im Westen je dokumentiert wurden, sind zur Zeit der größte sowie der dritt- und viertgrößte im Gange. Man nimmt die erschreckenden Forschungsergebisse von Ökologen zur Kenntnis, die in den Tagesnachrichten kurz zitiert werden, bevor man entschlossen zur Tagesordnung übergeht und, sofern man nicht selbst in Kalifonien lebt und jeden Abend den gespenstischen Feuerschein über den nahen Hügeln sieht, das Gesagte wieder vergisst. Dies, so liest man, sei erst der Anfang. Die extreme events nähmen dramatisch zu.
So fühlen wir uns mitten in unserem endlosen Warten unangenehm berührt. Wir winden uns, tun ab, vergessen, wenden uns anderem zu. In den Medien verhandeln die Kolumnisten lieber die Frage, ob es den versprochenen Corona-Impfstoff noch vor den Wahlen geben werde oder nicht – und seit diesem Wochenende auch, welche Auswirkungen die Erkrankung des Präsidenten haben könnte. In Europa dagegen verschwenden Tausende ihre Energie darauf, gegen das Maskentragen zu protestieren, weil mit solchen Vorschriften die Freiheit eingeschränkt und der erste Schritt zur Diktatur gemacht sei. Dass man dabei neben Reichsflagge schwingenden Faschisten marschiert, nehmen die Protestierenden nicht als Widerspruch wahr.
Sich einem Verschwörungsglauben zu verschreiben und vom deep state zu raunen, von dem keiner genau weiß, was er sein soll, dem aber alle möglichen Untaten und gegenwärtigen Unannehmlichkeiten in die Schuhe geschoben werden können, scheint vielen Menschen den Halt zu geben, den sie in unserer komplexen Wirklichkeit nicht mehr finden. Es ist so beruhigend wie bequem, Bill Gates und George Soros (mindestens ein liberaler Jude musste einfach dabeisein) die Schuld an allen Missständen, über die man sich gerade ereifert, zu geben. Diese allmächtigen Anführer einer dunklen, geheimnisumwobenen Elite sollen das ganze Weltgeschehen steuern. Durch Impfzwang, Finanzmanipulationen und ähnliche Machenschaften unterjochen und kontrollieren sie uns, während sie sich an einem Verjüngungsmittel, das aus dem Blut junger, unter ungeklärten Umständen verschwundener Kinder gewonnenen werde, schadlos halten. Dir werden diese Geschichten bestimmt vertraut sein. Sie vermehren sich exponentiell und schießen an allen Ecken und Ecken aus dem Boden. Ich schreibe von ihnen, als könnte ich mir dadurch das Denken – oder vielleicht eher das Fühlen – der Menschen, die solche Dinge glauben, besser erklären.
Ich brauchte lange, um einzusehen, dass ein alter Freund, der zu meiner Zeit am Gymnasium zu den jüngeren, cooleren Lehrpersonen gehörte, lange Haare trug und sich für Frauenrechte und Umweltschutz engagierte, zum verbissenen Verschwörungsanhänger geworden ist. Ob 9/11, Syrien oder Corona, immer entdeckt er in seinen Facebook-Beiträgen die gleichen dunklen Mächte hinter den Ereignissen und belehrt seine Leser, dass die Geschichten, die uns in den Medien erzählt werden, nichts als Lug und Trug seien und nur dazu dienten, die Machenschaften des deep state zu kaschieren. Ich machte mir die Mühe, seine Äußerungen zu den Anschlägen vom 11. September 2001, die sich vor allem auf die haltlosen Spekulationen Daniele Gansers stützen, zu widerlegen. (Das fiel mir nicht schwer, weil ich regelmässig ein Seminar zu 9/11 unterrichte und dabei neben literarischen Reaktionen auch politische Analysen und Gutachten von Waffenexperten und Ingenieuren behandle). Seine auf die Coronakrise bezogenen ellenlangen, in harschem Ton verfassten Ausführungen, die er sich von Skeptikern verschiedenster Couleur zusammenkopiert, sind widersprüchlich. Gemeinsam ist ihnen nur, dass jede offizielle Äußerung prinzipiell als Lüge abgetan wird. Ich wies meinen alten Freund mehrmals darauf hin, dass in allen seinen Verschwörungserzählungen Juden prominente Rollen zugewiesen werden und nicht wenige antisemitische Versatzstücke zum Einsatz kommen. Er könne gar nicht antisemitisch sein, antwortete er etwas gereizt, aber seiner Sache sicher, denn er sei mit einigen Juden befreundet und liebe die Musik Leonard Cohens.
In einem Eintrag zu den Protesten nach der Ermordung George Floyds auf seiner Facebook-Seite wurden die “aufgehetzten armen Schwarzen” als “nützliche Idioten im doppelten Sinne” beschimpft: “sowohl die Antifas als auch der deep State und die Oligarchen benötigen ihre Wut und Frustration, um eine schlagkräftige Armee zur Verbreitung von Chaos aufzustellen.” Ich schickte darauf meinem Freund einen Essay von Cornel West aus dem Guardian, um ihn mit der Situation der Schwarzen in Amerika etwas vertrauter zu machen. Dem engagierten Verschwörungsanhänger gelang es jedoch mühelos, auch Wests scharfsinnige Analyse in das Geraune vom deep state zu integrieren. Nicht eine halbe Stunde später meldete sich eine mir völlig unbekannte Frau zu Wort, aus deren wütender Tirade zu entnehmen war, dass wohl sie den zitierten Eintrag unter Pseudonym verfasst hatte. Diese Amerikanerin, die zur Zeit in Berlin lebt, viel zu reisen scheint und einen Doktorabschluss hat, schimpfte mich einen “Terrorist[en], der an der sinnlosen Zerstörung [ihres] Landes […] beteiligt [sei].” Auf ihrer Facebook-Seite schwärmt sie von der Kraft der Liebe und von Shakespeare, über den sie gearbeitet hat. Vielleicht müsste sie wieder einmal The Merchant of Venice oder Othello lesen.
Während man wartet, hat man Zeit, mit Gedanken und Assoziationen zu spielen, ohne Rücksicht darauf, was am Ende dabei herauskommt. Die Bilder von Anti-Corona-Protesten und kalifornischen Waldbränden, von schwarzen Männern, Frauen und Kindern, die niedergeschossen werden, und Mammutbäumen, die geschwärzt und versehrt noch stehen, während alles um sie herum verkohlt ist, überlagern sich, verschmelzen miteinander und gerinnen zum Sinnbild eines verlorenen Jahres. Dann ein anderer Gedanke: Facebook und die sozialen Medien sind der Flächenbrand der liberalen Demokratie. Diese Medien der Desinformation und der Parallelwelten, in denen einem der Algorithmus nur noch mit Nachrichten versorgt, die dem Profil und den statistisch festgestellten Präferenzen entsprechen, sind weit fortgeschritten in der Zerstörung des öffentlichen Diskurses, der die Bedingung einer funktionierenden Demokratie wäre. Das mediale Feedback zielt auf angenehme Zerstreuung, die uns das Warten, das kein absehbares Ende hat, eine Zeit lang vergessen machen soll. Mit der Zeit schlägt man die Wahrheit tot.
Wer sich dem Warten stellt, muss mit diesen Gedanken leben. Das Warten als Warten auszuhalten, ist eine unserer Zeit angemessene ethische Tat.
Liebe Gabriele, Du schreibst von Deiner Trauer und glaubst, über die weite Entfernung und die lange Zeit, die seit meinem letzten Brief vergangen ist, auch die meinige zu spüren. Und Du hast recht: Trauer liegt auf meinen Schultern wie eine Last von Scheitern. Nur dann und wann regt sich auch Wut – ohnmächtig, aber umso heftiger. Oft habe ich in den vergangenen Wochen an Dich gedacht und daran, wie geerdet Du mir scheinst in Deinen Briefen. Ich nehme das nicht als permanent etablierten Zustand wahr, eher als eine in jedem Augenblick dem Leben abgerungene Haltung.
Mit herzlichen Grüßen aus Ithaca, N.Y.,
Peter
19. Juli 2020
Lieber Peter,
es ist Sonntagmittag, ich sitze im Garten und sehe dem roten Milan zu, wie er seine Kreise zieht: diese begnadete Stille in seinem Flug, während der Lärm der Flugzeuge von den Felsen des Breitenbergs widerhallt. Ein Kohlweißling flattert im Fenchelhaar, und es sieht gar nicht aus, als habe er sich verirrt. Jetzt fliegt er von Gurkenblüte zu Gurkenblüte und steckt seinen Rüssel tief in die gelb leuchtenden Trichter. Die Hühner, Grace, Hannah und Eski klettern im Flieder herum, und vier junge Spatzen sitzen aufgereiht auf einem Stecken, der am Zaun lehnt. Bei der nächsten Gelegenheit werden sie durch das offene Törchen in den Stall fliegen und sich an der Futterschale gütlich tun. Zwei Mädchen führen ihre Pferde spazieren, ich kann sie nicht sehen, nur hören. Das Klappern der Hufe auf Asphalt – immer noch vermag dieser vierbeinige Rhythmus mir die Herztöne meiner Kinder in Erinnerung zu rufen, diesen ersten Klang des Lebens, das noch ungeboren in meinem Bauch mir schon Geschichten erzählte, von Schlaf, von Wachheit, von Neugier und Aufregung. Ich erinnere mich, wie gerne ich bei jedem einzelnen Kind in meinen Bauch hineingeschaut hätte, das Wunder zu begrüßen, und wie ich mir dann beibrachte, mich in mich selbst hineinzuträumen, in diesen Kern, der ich zugleich war und nicht mehr war. Diese Verbundenheit, die aus Verbundenheit entstand und immer weiterwächst. Ich habe noch das Geräusch im Ohr, das das Durchtrennen der Nabelschnur verursachte. Ich trage noch immer das Staunen darüber in mir, wie dem Geräusch diese Festigkeit, beinahe Härte dieses Stranges immanent war. Ich denke, dieses Geräusch war die Geburt meines Hörens.
Die Hühner scharren jetzt unter dem Flieder, in der trockenen Erde, ein Gemeinschaftsloch, um sich darin zu baden. Wie sie sich seitlich hinlegen und ihren Kopf rundherum bewegen, ist auch so ein Wunder. Aus Graces weißem Gefieder sieht man Erde wie Sand rieseln. Vielleicht ist es dieses Angebot an trockener Erde, das uns bislang vor Milben bewahrt hat. Hühner haben an und für sich eine starke Hackordnung, aber wie die drei da sich aneinanderschmiegen, die roten Kämme in die Federn der jeweils anderen versenken, wie sie gurren, wie sie scharren und sich räkeln – wie sie leise sind zusammen – im Moment kann ich mir kein schöneres Bild für Frieden vorstellen. Es tut mir unendlich gut.
Während die Hühner sich in Erde baden, tauchen die Enten – inzwischen sind es zwei, Bibi und Bobo – ihre Köpfe ins Wasser und schütten sich mit einem Ruck des Kopfes Wasser auf den Rücken. Dann stehen sie auf, recken sich und flattern mit den Flügeln, als wollten sie im Sekundentakt die Welt umarmen und umarmen und umarmen. Bibi, die Ente und Bobo, der Erpel, schnattern und quaken heute auch leise, als wüssten sie, es sei Sonntag, der erste Sonntag, den sie zusammen verbringen. Niemand hatte sie gefragt, ob es ihnen recht sei, dass man sie zusammenführe. Ich staune daher auch darüber, wie friedlich die beiden sich einen Stall teilen, wie einhellig sie miteinander unterwegs sind, wenn ich auch vermute, dass Bibi, die Ente, die schüchterne zuerst Dagewesene, jetzt etwas an Sicherheit gewonnen hat und Bobo, den Erpel, führt.
Unter dem Tisch, auf dem warmen Lattenrost, liegt Isis, die Katze, und döst. Wo Osiris, der Kater, sich rumtreibt, weiß ich nicht. Ich vermute, er liegt auf der Bank vor dem Schopf oder unter der Linde zwischen Stauden. Jedes Wesen hier hat einen Lieblingsplatz. Der Igel haust tatsächlich hinter den Brettern in der Laube. Ich habe ihn vorhin seltsam schnauben gehört. Ich habe zwar meinen Kopf durch Spinnenweben gesteckt, konnte ihn aber nicht wirklich sehen, er ist mit Heu zugedeckt. Was dieses Schnauben nun bedeutet, weiß ich nicht genau. Es klingt anders, als wenn Igel sich paaren. Vielleicht ist das ein Geburtsschnauben? Ich würde mich herzlich freuen, ich habe noch nie einen Babyigel gesehen.
Es ist ein Reichtum hier, der aus Unordnung geboren ist. Stünde der Stecken gerade, säßen keine Spatzen darauf. Stünden die Bretter nicht schräge, fände der Igel keinen Unterschlupf. Setzte das Blech keinen Rost an, kämen die Schnecken sehr schnell in das Hochbeet, das jetzt überquillt vor Grün in allen Nuancen: das von roten Adern durchzogene Grün des Randigs, dass wellende Hellgrün des Pflücksalats, das glänzende Mittelgrün der Pastinaken, das matte, rauhe Grün der Gurken, auf das ihre Ranken Kringelschatten werfen, das Herzgrün der Morning Glory, das sich zwischen das Gemüse schlängelt, das fingerhafte Grün des Ruccola, das jetzt schon nach den Nüssen zu greifen scheint, die ich erst knacken muss, um das weltbeste Pesto zu mixen, das blaublasse Grün des Lauchs, das jetzt in der Mittagswärme welkt, das spitze Dunkelgrün der Pfefferoni, das hellere Grün ihrer Früchte, das tanzend Bögen in den Strauch schreibt, das melierte Grün der Zucchini, das trichterförmig der Sonne zustrebt.
Und das ziselierte Grün des Fenchelhaars, mein Lieblingsgrün, ganz früh am Morgen ist es fast blau. Es fängt das Licht jetzt beinah ohne Schatten – deshalb könnte man das Ei des Schwalbenschwanzes auch deutlich erkennen. Rund ist es, kleiner als ein Stecknadelkopf, gelb zuerst und dann schwarz, wenn das Räupchen beginnt, das Ei auszufüllen. Nachdem das Räupchen geschlüpft ist, frisst es die Eihülle, weil sie aus Eiweiß pur besteht. Fünfmal häutet sich diese Raupe, jedes Mal frisst sie ihr altes Kleid und zeigt sich in einem neuen. Wenn sie ausgewachsen ist, ist sie so groß wie mein kleiner Finger. Dann sitzt sie im Fenchelhaar, diesen Ort nenne ich Scheitel. Mit ihren Hinterfüßen hält sie sich fest, mit den Vorderfüßen nimmt sie ein Haar und steckt es sich in den Mund und knabbert es in einer Schnelligkeit fertig, dass du laut lachen musst. Und wenn du um fünf Uhr früh dich in den Garten begibst, wenn die Tautropfen noch wie glitzernde Perlen im Fenchelhaar leuchten, dann musst du die Raupe trotz ihrer Größe suchen. Denn auch auf ihr liegen dann glitzernde Tauperlen, weil sie schläft, weil sie ruht. Und wenn du dich dann davor hinkniest, dann weißt du, du kniest vor dem Leben, vor seiner Lebendigkeit, vor der Schönheit von Wachsen und Werden.
Wenn die Raupe fühlt, es ist Zeit, lässt sich von da oben im Fenchel – 1,5 Meter Höhe – runterfallen auf die Erde. Dann findet sie ihren Weg, manchmal dauert das Stunden. Auf der Erde tut sie sich leichter als im Gras. Das erste Mal, als ich das sah, war ihr Ziel die Gurke. Da klettert sie hoch, findet einen Platz am Stamm. Dann verankert sie sich mit dem Hinterteil an diesem Stamm und lehnt sich zurück. Dann beginnt sie einen eigenartigen Tanz von links nach rechts und von rechts nach links um den Stamm herum – sie spinnt Seidenfäden um den Stamm und auch einen Seidenfaden um sich selbst. Das nennt sich Gürtel. Wenn sie fertig ist, lehnt sie sich im Gürtel zurück und verharrt. Und ganz allmählich wird sie einheitlich grün (auf Himbeeren braun) und bekommt eine andere Form, als wüchsen ihr Ohren. Wenn du dann um fünf Uhr früh das Wesen besuchst, das in der Zwischenzeit fast golden glänzt, und erkennst, die Stacheln der Gurke haben die Puppe im nächtlichen Sturm verletzt, sie lebt nicht mehr, Schwarz rinnt aus ihr, das aussieht wie Pech, dann kannst du es zuerst kaum fassen. Ameisen mit ihrem sechsten Sinn für den Tod machen sich längst an ihr zu schaffen. Wenn du dann davor hinkniest, dann weißt du, du kniest vor dem Leben, vor seiner Lebendigkeit, vor der Schönheit von Wachsein und Sterben.
Und du glaubst es nicht: In diesem Moment, da ich noch immer im Schreiben um dieses nichtvollendete Wunder trauere, fliegt ein Segelfalter vorbei! Er hat die Robinie umkreist. Seit sechs Jahren habe ich hier keinen mehr gesehen. Jetzt lehne ich mich zurück und mache eine Übung. Einmal ist es mir gelungen, da hat mich der Schmetterling erhört: Ich saß ganz still, hab seine Bewegung tief in mich aufgenommen und bat ihn, sich mir zu zeigen. Die Kamera hatte ich ruhig in der Hand. Als es schwarz wurde vor meinen Augen, dachte ich, ich hätte versagt. Da saß der kleine Kerl oder die Kerlin doch direkt auf dem Objektiv. Ich kann nicht sagen, was Glück ist, ich kann es nur mit unbeholfenen Worten beschreiben.
Wenn er nur käme, dieser Segelfalter, und Eier ablegen wollte auf meinem Fenchel! Ich kann nicht mehr tun, als eine herzliche Einladung auszusprechen. Ich würde mich in der Tat geehrt fühlen. Die herbstliche Puppe auf dem Himbeerstrunk hat damals vermutlich der Igel gefressen.
Diese Puppe – was da in ihrem Inneren geschieht – ich weiß nicht, ob irgendjemand wirklich weiß, was da in der Metamorphose geschieht. Ich stelle mir vor, dass alles Gewebe in einzelne Zellen zerfällt, dass manche Raupenzellen beginnen, sich in Schmetterlingszellen zu verwandeln, dass diese jedoch immer wieder von Raupenzellen gefressen werden bis irgendwann die Zahl an Schmetterlingszellen so groß ist, dass sie gewinnen. Wenn die kritische Masse erreicht ist, der Kampf vorüber ist, alle ihrer neuen Bestimmung entgegengehen, dann wird das einstmalige einmalige Fallen aus großer Höhe verdichtet zum zukünftigen Flug.
So schaue ich in die Welt in den letzten Wochen und meine Trauer und meine Freude wechseln sich ab in einer Schnelligkeit, dass mein Kopf müde wird von der Schwere meines Herzens. Es gab mehrere Briefanfänge an dich, lieber Peter, und ich habe sie alle bis auf einen verworfen. Dieser begann am 29.06.2020 so:
Lieber Peter,
es war Dürre, als ich Dir zuletzt schrieb. Es war Winter, als ich, bang geworden, Deiner Antwort harrte. Es war Regenzeit, als in Wien die Menschen auf die Straße gingen, um ihren Protest kundzutun, um ihre Solidarität mit BLM zu zeigen. Es war Hitzezeit, als Vorarlberger*innen eine Petition zur Erhaltung des von anderen als schwer rassistisch empfundenen Logos der Mohrenbrauerei starteten. Es war Eiszeit, als ich hörte, dass der amerikanische Präsident bereit sei, die Armee gegen das eigene Volk einzusetzen. Es ist wieder Regenzeit, jetzt, da hier das Bundesministerium für Inneres zum zweiten Mal Serverausfälle verbucht, die das Unterschreiben des Klimavolksbegehrens teilweise verunmöglichen. Es ist Dunkelzeit, da der Kanzler im Ibiza-Untersuchungsausschuss sich insgesamt 68 Mal auf sein Vergessen beruft. Es ist Lichtzeit, wenn Doseh, unser in Togo geborener Freund, uns besucht und sagt, wir seien Heimat für ihn – und es ist gleichzeitig Eiszeit, wenn er, beinahe beschämt, sagt, er sei froh, dass der Aufenthalt seiner Tochter in Chicago nicht zustande käme, er hätte zu viel Angst um sie gehabt.
Wäre es vermessen, aufgrund dieser wenigen, ausgewählten Verwerfungen zu sagen, das atmosphärische wie auch das politische Klima der Welt befände sich in einer Art Klimakterium? Es würde bedeuten, wir stünden an einem kritischen Punkt.
Meine Zeilen an Dich wurden von einem verräterischen „poing“ unterbrochen und ich stürmte nach draußen.
Die Amsel im Karton hat Körner gespuckt. Ihr Fuß scheint gebrochen und ich weiß nichts über Vogelfußschienen. Zwischen Tageslichtnelken und abgeblühtem Storchenschnabel habe ich den Karton gestellt, schwere Tröge, als Hemmung gegen Isis und Osiris. Darüber biegt sich der Pfirsichbaum, Sonne fällt durch den Regen. Tiecks Gedicht in der Fensterscheibe hat den Todesflug nicht beendet. Weiße Kreide in Schönschrift unterstreicht wohl die tödliche Täuschung. Wie schaffe ich es, dass mir das Wesen nicht unter den Fingern verstirbt? Ich ziehe das Rollo an der Falle herunter. Wehmut, Sehnsucht und der Liebe Schmerzen lass ich noch lesbar stehen. Besser wäre, die Bedrohung deutlich auszumalen, Raubvögel als Schatten, ihren stehenden Flug gegen An- und Durchflugstendenz gegen die eigene Unzulänglichkeit zu simulieren.
Es hat Stunden gedauert, in denen ich die Amsel streichelte, ihr gut zuredete, ihr Apfelscheiben und Wasser bot, bis sie, in einem kurzen Erschrecken sich fasste und davonflog. Ich wünsche mir sehr, dass sie überlebt hat. Ich hatte vergessen, das zweite, kleinere Küchenfenster mit einem Vorhang zu versehen, das stimmte mich zu all den gehörten Nachrichten zusätzlich traurig.
Der Tag hatte Schlagseite. Mir kamen die Augen einer sterbenden Meise in den Sinn, die in der Hitze regelrecht ausflossen. Ich versuchte mich in einem Gedicht.
ich muss den verstand ausschalten | er sieht | was nicht ist |
er sieht es | mit augen | die der welt | nicht geboren |
denen | in dieser hitze | das weiß aus dem glaskörper | rinnt |
die letzte träne | will ich mir nur | weinen | dem | was jenseits von leben | mir blieb |
die letzte träne | muss ich bewahren | für mich | die nicht ist |_| die nicht ist | mit offenen augen | die aus der welt gehoben | deren trauer | als letzter sinn sich gibt |
ich muss | diesen letzten sinn beklagen | der davon singt | was nicht ist | : |
ein so unveräußerlicht lied | in dem hitze die kälte einfriert |
und kälte das eis zu schmelzen anrührt |
dieses letzte lied | muss ich weinen | es klingt wie stummes erstarren |
wie tote augen | die sich in drohnen verwandeln | es klingt wie hinterhaltsschüsse auf kleine kinder |
es klingt wie ein orchester | aus korrumpierendem handreichgewinde |
ich muss den verstand ausschalten | ich muss diese träne aushalten |
in ihr pocht das herz | der amsel | des zeisigs | der mönchsgrasmücken |
in ihr rauschen kronen der wälder | in ihr muss ich | meine liebeslücken |_| verwalten |
Ich war lange nicht fähig, weiter zu schreiben…
*
Es ist schon fünf Uhr geworden. Um diese Zeit summt unsere Hauswand. Hunderte von Bienen laben sich an den Blüten des wilden Weines. Doseh hat einen Bienenstock in unseren Garten gestellt. Er hat uns erzählt, dass die Bienen, die in großen LKWs in Amerika zu den riesigen Feldern zur Befruchtung gefahren werden, gleich nach ihrer „Arbeit“ sterben, weil die Farmer sofort nach der Befruchtung die Felder niederspritzen.
Ich habe mich lange gefragt, ob unser Umgang mit Tieren, ob der Umgang von Männern mit Frauen, ob der Umgang von Weißen mit Schwarzen nicht eine gemeinsame Wurzel haben. Ich glaube, die gemeinsame Wurzel ist der Beginn von „Besitz“. Erst als der Mensch sesshaft wurde, so denke ich, konnte er beginnen zu horten und die Ernte als seinen Besitz zu betrachten. Und danach war es nie mehr genug. Weiße besaßen Schwarze, Männer besaßen und besitzen Frauen, Unternehmer*innen besaßen und besitzen die Arbeitskraft ihrer Angestellten oder Lohnarbeiter*innen, Eltern besitzen ihre Kinder, der Staat besitzt die Kinder…
Ich habe mir die Dokumentationen von Ava du Vernay angeschaut – die Insassen in den privatisierten Gefängnissen in Amerika werden als Besitz betrachtet und müssen Gewinn für die Betreiber erwirtschaften. Das ist die direkte Weiterführung des Systems „Sklaverei“, wie wir sie auch in China und ichweißnichtwosonstnoch finden, wenn man weiß, dass die meisten von diesen Insassen gar nie einen Prozess bekommen, sondern Deals eingehen, weil sie sich einen Anwalt gar nicht leisten können.
Dieses Besitzdenken ist so tief in unseren Köpfen, dass wir, sobald wir einen Menschen sehen, der ärmer oder anderer Hautfarbe ist, unsere Vorurteile bedienen, dass dieser Mensch uns etwas wegnehmen könnte, während wir selbst andererseits nach oben schauen und gerne den Reicheren angehören würden. Stell dir vor, die Menschen könnten alles, was sie wissentlich oder unbewusst als ihren Besitz betrachten im Tod auf die andere Seite mitnehmen. Ich bin überzeugt, die Welt wäre ziemlich leer. Sie wäre ein karger Mond, der von anderen Wesen im Universum (falls es sie gibt) ins Auge gefasst würde, um dort Gesteine und Erze zu schürfen.
Wenn ich genauer darüber nachdenke, dann unterliegt allen Todsünden eigentlich dieses Besitzdenken. Sogar das Nichtstun, den Müßiggang kann man besitzen wollen – vielleicht liegt genau darin die Angst der Regierenden, ein Grundeinkommen auszuschütten. Dass Menschen ein mögliches Nichtstun besitzen. Wäre das Freiheit, über das, was ich tue und in welchem Ausmaß ich es tue, selbst zu bestimmen?
Doseh hat mir auch die Geschichte von Miles Davis erzählt, die du in deinem Brief erwähnst, kurz bevor er ankam. Ich weiß um den Rassismus hier im Land, seit ich Doseh kenne, seit Jahrzehnten. Ich weiß, wie unsere Gesellschaft mit Menschen anderer Hautfarbe, anderer Sprache, anderer Religion, anderer Sexualität umgeht. Ich weiß, wie unser System mit Frauen umgeht. Das viele Wehren, das immer noch sich ausdehnen müssende Wehren macht mich zunehmend mürbe.
Also blicke ich jetzt wieder auf die Hühner, die sich plötzlich daran erinnern, dass sie Vögel sind. Eski ist im Flieder von Ast zu Ast geflogen. Der letzte Ast verläuft knapp über dem Maschendrahtzaun und parallel zu ihm. Jetzt sitzt sie da und schaut mich an. Ich muss grinsen. Wir hatten noch nie fliegende Hühner. Aber sie dreht um, während Grace auf einem Ast abwärts rutscht. Ich kann es kaum fassen: Hühner, die auf Ästen rutschen. Es fehlt nur noch eine Schaukel!
Lieber Peter, es ist Abend geworden. Mein Sohn David ist zu Besuch gekommen, um mit meinem Mann das Feld zu begehen, das bewirtschaftet werden soll. Es ist schön, die beiden dorthin gehen zu sehen. Beide sind in blau gekleidet, des einen Haare strahlen in Weiß, des anderen in Blond. Und wie sie da gehen, ist Sonntag. Ich bin so gesegnet.
Und so sitze ich noch ein bisschen, umgeben von Getier und Gemüse und bin dankbar für diesen Tag. Der Segelfalter hat sich leider nicht mehr blicken lassen, dafür kreisen drei Segelflieger im Aufwind des Bergs. Die Tagesausflügler kehren mit ihren Autos zurück, im Hintergrund höre ich Nachbarn einander einen schönen Urlaub wünschen.
Und so möchte ich auch Dir einen schönen Sommer wünschen und hoffe, dass Dich diese Zeilen bei bester Gesundheit erreichen!
Herzlich,
Gabriele
Hohenems, den 19.07.2020
26. Juni 2020
Liebe Gabriele,
„Einst war der Strang die klassische Methode des Lynchens. Jetzt ist es die Kugel des Polizisten. Für viele Amerikaner ist die Polizei die Regierung oder zumindest ihre sichtbarste Vertretung. Wir behaupten, dass die Befunde nahelegen, dass das Töten von Schwarzen zur offiziellen Polizeistrategie geworden ist und dass die Strategie der Polizei der deutlichste praktische Ausdruck der Strategie der Regierung ist.”
Vor ein paar Tagen stolperte ich bei meiner Lektüre über dieses Zitat. Ich übertrug es möglichst genau ins Deutsche, um die Worte nicht nur verstehen, sondern auch das sie animierende, mit fast übermenschlicher Disziplin unter Kontrolle gehaltene Beben fühlen zu können. Nur zwischen den Zeilen wird die Entrüstung, der Zorn der Verfasser hörbar: ein lähmendes Schweigen über ihr eigenes Leiden, das all jenen abverlangt wird, die sich ihr Recht auf amtlichem Weg verschaffen wollen in einer Gesellschaft, die es ihnen vorenthält. Man möchte meinen, diese sachliche Anklage sei unter dem Eindruck der Ereignisse vom 25. Mai 2020 geschrieben, als George Floyd, ein wehrloser und unbewaffneter Mann in Minneapolis am hellichten Tag von drei Polizisten brutal ermordet wurde, während ein vierter lautstark protestierende Passanten auf Distanz hielt. Tatsächlich stammen die Sätze aus einer von schwarzen Bürgerrechtlern 1951 an die UNO adressierten Petition, die unbeantwortet blieb.
Kommentare, die oft in ähnlichen Worten nichts anderes sagen, waren nach Floyds Tod in vielen Zeitungen und im Internet zu lesen oder in Fernseh- und Videosendungen rund um die Welt zu hören. Als wäre es den meisten Lesern und Hörern und selbst den Schreibenden erst in den letzten Wochen bewusst geworden, dass es diese Zustände noch immer gibt und dass die lange Kette der Unterdrückung sich von der Sklaverei über die gesetzlich verordnete, erbarmungslos durchgesetzte Rassentrennung bis zur weiterhin bestehenden massiven Benachteiligung, sei es im Wirtschafts-, Bildungs- oder Gesundheitssystem, fortsetzt. Als hätte man bisher kaum oder nur schulterzuckend zur Kenntnis genommen, dass schwarze Männer mit erheblich grösserer Wahrscheinlichkeit als ihre weissen Pendants für die gleichen Vergehen jahrelang ins Gefängnis gesteckt oder in einigen Bundesstaaten auch hingerichtet werden. Als hätte man vergessen, dass selbst eine Pandemie unter der schwarzen Bevölkerung hierzulande ein Mehrfaches an Opfern fordert, nicht wegen besonderer genetischer Veranlagungen, sondern aus dem einfachen Grund, dass in diesem Land die ärmere Bevölkerung froh sein muss, wenn sie überhaupt Zugang zu einer funktionierenden medizinischen Versorgung hat. Als hätte man noch nie selbst erlebt, wie eine Person schwarzer Hautfarbe öffentlich beleidigt, gedemütigt und diskriminiert wird. Als wäre all dies nur eine Randerscheinung dieser Great Nation, die sich seit ihrer Gründung als das neue erwählte Volk sieht – so schon Thomas Jefferson, der grossartige Philosoph, Aufklärer, Staatsmann, Gründervater und dritte Präsident der jungen Republik, der sich bis zu seinem Lebensende nicht dazu aufraffen konnte, die Sklaven, die er hielt, in die Freiheit zu entlassen. All dies in einem Land, das für sich in Anspruch nimmt, 1776 mit der Unabhängigkeitserklärung als erste Nation in der Geschichte auf der Grundlage gleicher Rechte für alle gegründet worden zu sein.
Liebe Gabriele, als ich Deinen genau argumentierenden und meine Gedanken und Argumente zur Coronakrise herausfordernden zweiten Brief erhielt, wollte ich Dir sogleich antworten. Doch zwischen dem Sonntag, auf den Dein Brief datiert ist, und dem Mittwoch, als ich ihn in meiner Inbox fand, liegt jener 25. Mai: Eine Zäsur in der Geschichte dieses Landes, die, so wage ich zu behaupten, derjenigen in den späten 60er Jahren in nichts nachsteht. Man wird einst von der Zeit davor und danach sprechen. George Floyd, der mit der grossen Geschichte nichts am Hut hatte und sich durchschlug, so gut es ging, der von Houston, wo er ein Kleinkrimineller gewesen war, wegzog, um im fernen Minneapolis ein neues Leben zu beginnen, und der sich in den sieben Jahren seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis nichts mehr zuschulden kommen liess – dieser George Floyd wird der historischen Wende, die wir gerade erleben, den Namen gegeben haben. Er war kein Martin Luther King, und wie viele andere von Polizisten ermordete Schwarze, deren Namen uns die Bewegung Black Lives Matter in Erinnerung ruft, hatte er nicht das Glück eines Rodney King, der die auf ihn wie ein ungnädiges Schicksal niedergehende Polizeibrutalität überlebte. Seit Floyds Tod sind schon wieder mehr als ein Dutzend schwarze Menschen unter fragwürdigen Umständen von Polizisten getötet worden, nicht zu reden von den zahlreichen Fällen allein im laufenden Jahr, in denen Polizisten und Ex-Polizisten aus geringfügigen Gründen schwarze Menschen umbrachten.
Vor einigen Tagen las ich, dass in Südkalifornien am 31. Mai und am 10. Juni die Leichen zweier junger schwarzer Männer gefunden wurden. Man hatte sie etwa 80 Kilometer voneinander entfernt an Bäumen aufgehängt. Die Polizei ging von Selbstmorden aus, obwohl die Symbolik und, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, die Indizienlage eindeutig sind.
Vor achtzig Jahren hatte Billie Holiday mit schmerzdurchdrungener Stimme die seltsamen, im Süden der USA an den Bäumen baumelnden Früchte besungen:
Southern trees bear a strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black bodies swinging in the Southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Kann dieses Lied, um es mit Kafka zu sagen, etwas anderes sein als “die Axt für das gefrorene Meer in uns”?
Lady Day sang Strange Fruit immer am Ende ihres Sets. Dann ging das Licht aus, und als es wieder anging, war die Bühne leer. Schon nach den ersten dieser Auftritte wurde die Sängerin zur Zielscheibe von Rassisten. Besonders der mächtige Harry Anslinger, der 32 Jahre lang dem Federal Bureau of Narcotics vorstand, nutzte seine Stellung, um Holiday zum Schweigen zu bringen. Er untersagte ihr, das Lied weiterhin zu singen. Als die Sängerin sich seiner Anordnung widersetzte, liess er sie wegen ihrer Drogenprobleme verhaften. Sie sass mehr als ein Jahr im Gefängnis. Nach Ihrer Entlassung wurde ihr die Lizenz für weitere Auftritte in Nachtclubs verweigert. Als Billie Holiday 1959 mit fortgeschrittener Leberzirrhose und herzkrank im Krankenhaus lag, liess Anslinger sie mit Handschellen ans Krankenbett fesseln. Er verbot den Ärzten jede weitere Behandlung. Lady Day starb wenige Tage später. Sie war 44 Jahre alt.
Es ist eine bittere Ironie, dass auch Holidays Vater in einem texanischen Krankenhaus nur für Weisse, in das er als Notfall eingeliefert worden war, die medizinische Behandlung verweigert wurde. In ihrer 1956 veröffentlichten Autobiographie Lady Sings the Blues schreibt Holiday, dass Strange Fruit sie an das Schicksal ihres Vaters erinnerte und dass sie sich jedesmal dazu zwingen musste, das Lied zu singen. Sie habe es nur deshalb getan, “weil 20 Jahre nach Papas Tod das, was ihn umgebracht hat, in den Südstaaten noch immer gang und gäbe ist.”
Seit ich vor mehr als dreissig Jahren erstmals in die Vereinigten Staaten kam, hat der staatlich sanktionierte Terror gegen schwarze Menschen nie aufgehört. Jedes Jahr gibt es Einsätze, bei denen die Polizei versehentlich einen Afroamerikaner tötet, einem verletzten schwarzen Verhafteten keine medizinische Hilfe zukommen lässt oder dunkelhäutige Menschen in Einkaufszentren auf erniedrigende Weise kontrolliert, weil sie angeblich dem Profil irgendeines Verdächtigen entsprechen. Regelmässig sprechen Politiker dann von bedauerlichen Einzelfällen oder geben Beamten die Schuld, die ihre Kompetenzen überschritten hätten und gegen die nun eine Untersuchung eingeleitet werden müsse. Man muss kein besonders geübter politischer Beobachter sein, um zu erkennen, dass in diesem Land die Gewaltbereitschaft der Polizei und der systemische Rassimus zwei Seiten derselben Medaille sind.
Das wollen viele Amerikaner nicht wahrhaben. Ich meine hier nicht die fanatischen Anhänger eines unfähigen Präsidenten, der in Wort und Tat offene Anleihen beim Faschismus macht, um sich als Kämpfer für Recht und Ordnung zu inszenieren und von seinem Versagen in der Coronakrise abzulenken. Bei ihnen habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich meine eher Menschen, die sich liberal geben, in vielen Fällen eine gute Ausbildung genossen haben und komfortabel leben – vielleicht ein bisschen zu komfortabel – und die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit mit allerhand sophistischen Argumenten rhetorisch neutralisieren. Doch in dieser Frage gibt es keine zwei Seiten und daher auch nichts, was neutralisiert werden könnte. Neutralität steckt mit der Unterdrückung unter einer Decke. Darin liegt ihre besondere Perfidität.
Soweit wir wissen, wurde George Floyd zu keinem Zeitpunkt gewalttätig. Das erste Polizeibulletin, veröffentlicht, als noch niemand wusste, dass nahezu der ganze Vorfall von mehreren Sicherheitskameras und den Handys einiger Augenzeugen aus verschiedenen Perspektiven aufgezeichnet worden war, war eine Lüge. Man behauptete, Floyd sei wegen Gesundheitsproblemen zusammengebrochen, worauf man einen Krankenwagen angefordert habe. Ich habe mir alle veröffentlichten Aufnahmen immer wieder angesehen. Floyd scheint mit der Polizei zu kooperieren. Erst als er in den Polizeiwagen einsteigen soll, gibt es eine Verzögerung. Es ist möglich, dass er sich widersetzt. Man kann es auf dem Video nicht genau erkennen. Wenige Sekunden später liegt George Floyd bereits am Boden, die Hände hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Er liegt auf dem Bauch und hat keine Möglichkeit sich zu wehren. Ein Polizist drückt sein Knie mit aller Kraft 8 Minuten und 46 Sekunden lang auf den Hals des Verhafteten und reagiert nicht, als dieser röchelt, sich windet und wiederholt bittet: “Please, I can’t breathe, man, please.” Dazwischen ruft der 46 Jahre alte, kräftige Mann auch einmal verzweifelt nach seiner toten Mutter. Der Polizist macht weiter. Dann verstummt George Floyd. Sein Körper erschlafft. Zivilisten in der Nähe flehen die Polizisten an, endlich vom Mann, der sich nicht mehr bewegt, abzulassen.
Es ist, als hätte George Floyd, der mit einem falschen 20-Dollar-Schein Zigaretten kaufen wollte, im Moment seiner Ermordung einen anderen unbewaffneten schwarzen Mann zitiert, der 2014 in New York umgebracht wurde. Ein Polizist hatte Eric Garner, der an einer Strassenecke illegal Zigaretten verkaufte, mit einem verbotenen Würgegriff getötet. In Todesangst rief auch Garner: “I can’t breathe!” Es waren seine letzten Worte.
In einer perfekt konstruierten Geschichte wäre 2008 der Höhepunkt gewesen, an dem sich ein dauerhafte Veränderung ereignet hätte. Man kann sich die unbändige Freude, die Begeisterung und den Optimismus der schwarzen Bevölkerung kaum vorstellen, als Barack Obama zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Doch die reale Geschichte hielt sich nicht an das ideale Drehbuch. Die Rede von der Überwindung des Rassismus war verfrüht und vor allem der eigenen Erleichterung geschuldet. Wir wollten mit aller Macht daran glauben, dass das historische Versprechen der Vereinigten Staaten endlich eingelöst werde: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” (Präambel der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776)
Ein Versprechen, hinter dem die Verbrechen an der schwarzen Bevölkerung, die seit 4 Jahrhunderten andauern, verschwinden sollten: ungeschehen gemacht und durch diese schönen Worte schmerzlos gesühnt. Die ersten amerikanischen Sklaven wurden aus dem Königreich Ndongo im heutigen Angola verschleppt. Sie kamen 1619 in Virginia an. Bis auf den heutigen Tag sind die unveräusserlichen Rechte ihrer Nachkommen etwas weniger unveräusserlich als diejenigen ihrer weissen Mitbürger.
Lassen wir uns nicht täuschen: Es gibt noch immer genug uneinsichtige Polizeivertreter und militante Anhänger des Präsidenten, der von Anbeginn seiner Amtszeit seine Sympathie für Rassisten offen zur Schau stellte. Der 2004 für ein Ministeramt vorgeschlagene ehemalige New Yorker Polizeichef Bernard Kerik meinte in einem Interview mit dem Fox-Fernsehsender zur Ermordung George Floyds: “Solche Dinge passieren halt.” Das wirkliche Ärgernis sei, dass die Proteste vom demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden angestachelt würden, während im Hintergrund der jüdische Milliardär George Soros die Strippen ziehe. Die Interviewerin fragt ihn mit gespielter Entrüstung: “Können wir das wirklich sagen? Wissen wir das auch sicher? George Soros? Joe Biden? Wissen wir das?” Darauf Kerik: “Nun, dies sind Berichte – von etablierten Nachrichtenquellen verfasste Berichte!” Welche Quellen er damit gemeint haben könnte, bleibt sein Geheimnis.
Um Kerik überhaupt als ausgewiesenen Experten präsentieren zu können, muss Fox auf die Vergesslichkeit seiner Zuschauer hoffen oder darauf, dass sich das Stammpublikum von Verfehlungen und Verbrechen nicht irritieren lässt, solange die politische Richtung stimmt. Denn die zunächst glänzende Karriere Bernard Keriks endete abrupt, als er 2009 wegen mehrfachen Steuerbetrugs verurteilt wurde. Die beanstandeten Geldzuwendungen waren erfolgt, als Kerik 2003 nach der Invasion vorübergehend im Irak als Innenminister tätig war. Er legte ein Geständnis ab und verbüsste seine Strafe. Trotzdem wurde er im vergangenen Februar nachträglich von Donald Trump in allen Punkten begnadigt, was auch bedeutet, dass sein Vorstrafenregister gelöscht wurde. So wäscht eine Hand die andere, und ein Lügner lügt zugunsten des anderen auf einem Fernsehkanal, der innerhalb von zwanzig Jahren zum Lügenkanal und Propagandainstrument des rechtsextremen Flügels der republikanischen Partei verkommen ist. Den Zuschauerzahlen hat das nicht geschadet. Ganz im Gegenteil: der Markt für Ressentiments und Verschwörungstheorien boomt.
Wie kann sich die Minderheit der Afroamerikaner unter den gegenwärtigen Bedingungen anders Gehör verschaffen als auf der Strasse? Alle anderen Beschwerden und Proteste verhallen seit Jahrzehnten ungehört oder werden unterdrückt. Als während der Spielzeit 2016/17 Colin Kaepernick, damals der Quarterback oder Spielmacher der San Francisco 49ers, begann, beim Abspielen der Nationalhymne auf die Knie zu gehen, um auf die Polizeigewalt gegen Schwarze aufmerksam zu machen, wurde er vom Präsidenten der Vereinigten Staaten als “Hurensohn” beschimpft. Viele Sportfans wollten keine politischen Gesten auf dem Rasen dulden. Man warf Kaepernick und den Spielern, die seinem Beispiel gefolgt waren, vor, sie missachteten die amerikanische Flagge und damit die Nation. Es gebe geeignetere Wege, politische Missbilligung kundzutun. Die National Football League tat alles, was in ihrer Macht stand, um den eindrücklichen stillen Protest zu unterbinden. Als Kaepernick sich nicht einschüchtern liess, ruinierte man seine Karriere. Seit die 49ers am Ende der Saison 2017 seinen Abgang erzwangen, sucht er, einer der talentiertesten Spielmacher seiner Generation, vergeblich nach einem neuen Team. Immerhin sah sich die Liga im Februar 2019 gezwungen, mit Kaepernick einen Vergleich abzuschliessen und ihm eine hohe Summe, über die Stillschweigen vereinbart wurde, zu zahlen, um die Weiterführung des von ihm angestrengten Diskriminierungsprozesses zu verhindern. Die National Football League wird es verkraften. Bald danach setzte man das Gerücht in die Welt, Kaepernick habe den Zenith seines Könnens ohnehin überschritten und widme sich lieber anderen Projekten.
Wie in diesem Fall kommt schwarzer Protest auch für manche liberale Weisse, die sich davon unangenehm berührt fühlen, stets zur falschen Zeit. Und nie ist es der richtige Ort, nie die passende Gelegenheit, nie der angemessene Ton. Den Sport will man sich nicht von politischen Fragen verderben lassen. Bei Hollywood-Preisverleihungen wird mittlerweile das Orchester instruiert, sobald eine Rede allzu politisch wird, möglichst laut zu spielen, um den Redner zu übertönen. Bei Campus-Protesten stören sich konservative Studenten daran, dass so etwas gerade in den heiligen Hallen von Wissenschaft und Bildung stattfinden müsse. Und wenn die Protestierenden auf die Strasse gehen, um unübersehbar und lautstark auf ihre Unterdrückung hinzuweisen, wird ihnen gesagt, anstatt zu randalieren, hätten sie sich doch viel eher und ganz zivilisiert bei den entsprechenden Stellen beschweren können, die es im Rechtssystem der Vereinigten Staaten mittlerweile durchaus gebe; man habe schliesslich dazugelernt.
Dass es strukturellen Rassismus gibt, ist für jene, die nicht davon betroffen sind, oft schwer nachzuvollziehen. Als ich vor über 30 Jahren in Chicago lebte, erklärte mir eine afro-amerikanische Studentin, wie sehr ein diffuser Rassismus, für den sich niemand verantwortlich fühle, ihren Alltag präge. Sie erzählte davon, wie man ihr unterschwellig und doch deutlich zu verstehen gebe, dass sie in gewissen Restaurants oder Geschäften nicht willkommen sei, vor allem wenn sie einen weissen Mann begleite. Wenn sie in den exklusiven Kaufhäusern einkaufen gehe, merke sie oft sehr schnell, dass jede ihrer Bewegungen von einem Kaufhausdetektiv beobachtet werde. Ausserdem seien Kosmetika für schwarze Frauen in einer separaten Virtrine eingeschlossen, während sich weisse Frauen ihre Hautcremes einfach aus dem Regal nehmen könnten. Dieser stillschweigende Generalverdacht, gebe ihr das Gefühl, etwas Minderes zu sein.
Ich war verlegen und beteuerte schnell, dass ich als gerade erst ins Land gekommener Europäer nichts davon wisse und nichts damit zu tun habe. Ich muss zugeben, dass ich wohl auch etwas skeptisch war, denn ich konnte mir das Ausmass des real existierenden Rassismus nicht vorstellen. Vielleicht war meine Bekannte besonders empfindlich, weil ihr ein Unrecht widerfahren war? Was tut man nicht alles, um unbequemen Fragen auszuweichen – Fragen, von denen man weiss, dass sie einen angehen, auch wenn man sich selbst umso lauter für nicht zuständig erklärt. Nicht dass ich Zweifel an den Erfahrungen dieser Frau geäussert hätte. Wie hätte ich das als Neuankömmling in ihrem Land auch tun können? Eher war es ein inneres Distanz-Halten: die bequeme Illusion, dass mich all die geschilderten Vorkommnisse nicht betrafen, weil ich Ausländer war – noch dazu aus einem Land, in dem es diese Probleme nicht gab.
War ich wirklich davon überzeugt, dass es in der Schweiz und in Liechtenstein, den beiden Ländern, in denen ich vor meiner Ankunft in den USA gelebt hatte, keinen Rassismus gab? Man wusste schon damals, dass ein Konfekt nicht “Mohrenkopf” heissen sollte, und dass stereotype Abbildungen von schwarzen Menschen auf Kaffeeverpackungen, Bierflaschen und Wirtshausschildern nichts zu suchen haben. Mehr als dreissig Jahre später werden immer noch die gleichen Ausreden angeführt, als ob es geradezu unvorstellbar wäre, andere Namen und Bilder für diese Dinge zu finden.
Wenn ich in den Online-Zeitungen meiner beiden Heimatländer die Lesermeinungen und Kommentare lese, die sich auf die Macht der Tradition und Ähnliches berufen, fallen mir die italienischen Gastarbeiter ein, die in meinem Dorf lebten, als ich ein Kind war. Am Samstag standen sie vor der Telefonzelle beim Postgebäude Schlange, um für ein paar Minuten mit ihren Familien sprechen zu können. Die meisten von ihnen waren sogenannte Saisonniers. Sie waren allein gekommen. Sie durften ihre Frauen und Kinder nicht mitbringen. Erst im Winter, wenn das Baugewerbe ruhte, kehrten sie zu ihnen in den Süden zurück.
Es gab nur wenige Familien unter ihnen: die Frauen und Kinder von Arbeitern, die eine feste Anstellung bekommen und deshalb das Recht auf Familiennachzug hatten. Ein solche Familie wohnte nicht weit vom Haus meiner Grossmutter in einem Gebäude, für das kein Liechtensteiner Miete bezahlt hätte. Die beiden Söhne, Antonio und Domenico, gingen in die gleichen Klassen wie ich und mein Bruder. Als Antonio in der zweiten Klasse zu uns kam, sprach er fast kein Deutsch. Der Lehrer machte von Anfang an klar, dass wir es hier mit jemandem zu tun hatten, der nicht zu uns gehörte. Einmal musste Antonio nach vorne ans Lehrerpult treten, und der Lehrer fragte ihn: “Antonio, wie heisst es: der, die oder das Sonne?” Und Antonio antwortete nach kurzen Zögern: “Der Sonne!” Dann fragte der Lehrer lächelnd: “Heisst es der, die oder das Mond?” Antonio antwortete: “Die Mond.” Der Lehrer wandte sich an die Klasse, zeigte auf Antonio, der neben dem Lehrerpult stand, und sagte: “Seht Ihr, das sind die Italiener! Die sagen il sole und la luna – der Sonne und die Mond. Die wissen es einfach nicht besser!” Am Ende des Schuljahres veranlasste der Lehrer, dass Antonio in die Schule für behinderte und zurückgebliebene Kinder überwiesen wurde, da er Sprachschwierigkeiten habe, beim Rechnen nicht mithalten könne und auch sonst wenig verstehe.
Antonio war oft traurig. Er kam mir zerbrechlich vor. Oft erzählte er mir, dass er eines Tages in sein Land zurückkehren und dort einen Bauernhof mit vielen schönen Tieren haben werde. Er konnte diesen fernen Tag kaum erwarten. Als ich einmal meiner Grossmutter von Antonio und dem Lehrer erzählte, unterbrach mich meine Tante und sagte, Antonio sei eben keiner von uns.
Ich wusste schon damals, dass auch ich keiner von uns war. Mein früh verstorbener Vater war Ausländer gewesen. Am Tag der Hochzeit verlor meine Mutter ihr Bürgerrecht. Erst viele Jahre später erhielt sie es nach einer Gesetzesänderung zurück. Wir Kinder blieben jedoch noch lange Ausländer. Jedes zweite Jahr hatten wir bei der Fremdenpolizei um Verlängerung der Niederlassungsbewilligung anzusuchen. Als Grund war anzugeben: “Verbleib bei der Mutter”.
Als ich in Amerika ankam, fühlte ich zunächst eine fast grenzenlose Freiheit. Das hatte nicht nur mit den vielen neuen Erfahrungen und der Grösse des Landes zu tun, mit der Intensität von Chicago und zwei Jahre später der landschaftlichen Schönheit und der Internationalität von Kalifornien. In der Bevölkerung der Bay Area um San Francisco, wo ich hinzog, um mein Studium fortzusetzen, sind auf engem Raum mehr Nationalitäten und Ethnien vertreten als irgendwo sonst auf der Welt. Bald erlag ich der Illusion, dass diese bunte, wirtschaftlich und kulturell führende Gegend ein Abbild der Vereinigten Staaten sei. Sonderlinge und Visionäre gab es zuhauf. Es schien, als ob es für jeden eine eigene Nische gäbe. Die Computerindustrie befand sich inmitten eines enormen Wachstumsschubs. Alle Ideen waren gefragt. Jeder, so schien es, konnte sein, was er wollte. Das Leben war leicht. Die Sonne schien 261 Tage im Jahr.
Die Idylle wurde bald durchbrochen. Am 3. März 1991 filmte ein unbeteiligter Mann in Los Angeles von seinem Balkon aus die Festnahme eines angetrunkenen Fahrers. Vierzehn Polizisten waren beteiligt. Vier davon prügelten mit ihren Schlagstöcken, die sie wie Baseballschläger zweihändig hielten, auf den wehrlos am Boden liegenden Rodney King ein. Als das Video veröffentlicht wurde, löste es einen Sturm der Entrüstung aus. Zur anberaumten Pressekonferenz konnte King, ein schwarzer Mann, nur im Rollstuhl erscheinen: Sein rechtes Bein war gebrochen. Sein Körper war von weiteren Frakturen und zahlreichen Schwellungen und Schnittwunden gezeichnet. Im Brustbereich erlitt King schwere Verbrennungen, als ihm einer der Polizisten mit einer Taser-Waffe einen 50’000-Volt-Elektroschock versetzte.
Die vier Polizisten mussten sich ein Jahr später vor Gericht verantworten. Zwölf Geschworene – zehn davon weiss, keiner schwarz – sprachen am 29. April 1992 wider Erwarten die Polizisten frei. Unter anderem war es ihnen nicht möglich, auf dem Video, das mehrmals in Superzeitlupe abgespielt wurde, den genauen Zeitpunkt auszumachen, in dem die Polizeigewalt das erlaubte Mass überschritten hatte. In einem Kommentar für die Los Angeles Times gab der Medientheoretiker Brian Stonehill zu bedenken, dass uns durch die enorme Verlangsamung der Filmbilder der Sinn für die alte Einheit der Zeit verloren gehe. Betrachte man degegen die Aufnahme in Realzeit, dann müsse man nicht fragen, was da geschehe: “In real time, there’s no question what’s happening on the tape.”
Muss man sich wundern, dass die Menschen das Recht in ihre eigene Hand nahmen und tagelang in Los Angeles randalierten? Erst der Einsatz der kalifornischen Nationalgarde und des amerikanischen Militärs vermochte den drohenden Aufstand einzudämmen. Unter dem Druck der Öffentlichkeit – will heissen: weil es die kompromittierende Videoaufnahme gab – wurden die Polizisten wegen Verletzung der Bürgerrechte Rodney Kings erneut angeklagt. Zwei von ihnen wurden verurteilt, die anderen beiden freigesprochen.
Herb, ein schwarzer Studienkollege, klagte ein paar Wochen später über die rassistische Polizei, weil er bei seiner Fahrt zur Universität von einer Streife angehalten und für zu schnelles Fahren gebüsst worden war. Ich gab zu bedenken, dass er doch die Geschwindigkeit übertreten habe und dies wenig mit Rassismus zu tun habe. “Nein,” sagte er, “da liegst Du falsch. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass ein Weisser an meiner Stelle nicht bestraft und wahrscheinlich nicht einmal angehalten worden wäre.” Herb, den ich kaum kannte, starb wenige Jahre danach an AIDS. Unser kurzes Gespräch blieb mir im Gedächtnis. Zwar war ich von seinen Argumenten nicht überzeugt, hatte aber zugleich unterschwellig das unangenehme Gefühl, dass Herb etwas Wahres benannt hatte. Man muss dazu wissen, dass in den USA ein Polizist einen Fahrer nur aufgrund eines begründeten Verdachts anhalten darf. Es gibt daher keine allgemeinen Geschwindigkeitskontrollen. Ein Polizist muss das fragliche Vergehen selbst gesehen haben, dem fehlbaren Lenker folgen und ihn zum Anhalten zwingen. Den Begriff des racial profiling kannte ich damals noch nicht.
Die entsprechende Praxis hatte ich jedoch schon öfter mit eigenen Augen gesehen. An einem Freitagabend fuhr ich von der Autobahn ab, die Palo Alto, den Mittelpunkt des Silicon Valley, vom heruntergekommenen East Palo Alto trennte, in dem vor allem die ärmere schwarze Bevölkerung lebte. Auf der Überführung hatten Polizisten Barrikaden errichtet. Jeder Schwarze, der die Grenze nach Palo Alto überquerte, wurde aufgefordert, sich auszuweisen, und gefragt, was er denn an einem Freitagabend in Palo Alto wolle. Die Polizisten wussten so gut wie ich, dass es in East Palo Alto nur einen einzigen Reggae-Club gab. Der Drogenhandel florierte auf dem dahinter liegenden Parkplatz, der vom spärlichen Licht, das aus der Tür des Clubs drang, kaum beleuchtet wurde. In Palo Alto dagegen gab es zahlreiche Bars und Clubs, in denen die Leute am Wochenende miteinander tranken und ausgelassen tanzten und sich amüsierten und dazwischen auf den Toiletten ganz unbehelligt von der Polizei eine Prise Kokain schnupften. Nachdem die Personalien aufgenommen waren, forderte die Palo Alto Police die Überprüften ohne weitere Begründung dazu auf, wieder nach East Palo Alto zurückzukehren. Die Barrikaden und Polizeiwagen mit ihren gespentisch rotierenden blau-roten Lichtern standen jedes Wochenende auf der dunklen Autobahnüberführung. Wenn dies in einer der liberalsten Kleinstädte im liberalsten Bundesstaat geschah, schoss es mir durch den Kopf, wie mochte es dann anderswo zugehen?
Ich wurde in all den Jahren nur einmal angehalten und kontrolliert: als ich bei einem Stoppsignal mein Auto weiterrollen liess, anstatt abzubremsen. Der Polizist erinnerte mich freundlich an die Verkehrsregeln und liess mich dann ohne die eigentlich obligatorische Busse weiterfahren. Dennoch fühlte ich mich ein wenig verletzt, wenn mir in einem Gespräch klar wurde, wie wenig meine guten Absichten als weisser Mann bedeuteten. Es fühlte sich wie ein Angriff auf mein Selbstverständnis an, wenn ich nach langen Diskussionen zugeben musste, dass auch ich von den Privilegien, die der systemische Rassismus Weissen gewährt, profitierte, ob ich wollte oder nicht. Oft dachte ich in den letzten dreissig Jahren an den Mann in Chicago, von dem ich Dir in meinem ersten Brief schrieb. Hätte er mir das Geld auch in die Hand gedrückt, wenn meine Hautfarbe dunkel gewesen wäre? Hätte ich in diesem Land, dem ich viel zu verdanken habe, dieselben Möglichkeiten gehabt, wenn ich aus einer nicht-europäischen Weltgegend gekommen wäre?
Was wüsste man nicht alles gern, und wird es doch nie wissen! Ich weiss nicht, wie es ist, nicht weiss zu sein. Ich weiss nicht, wie es sich anfühlt, wenn man wegen seiner Hautfarbe alle paar Tage bei irgendeiner Routinekontrolle aufgefordert wird, sich auszuweisen und anzugeben, woher man gerade kommt und wohin man will. Am ehesten kann ich diese Erfahrungen nachvollziehen, wenn ich mir ein Interview mit Miles Davis in Erinnerung rufe. Ich muss es zu jener Zeit gelesen haben, nachdem ich eines seiner letzten Konzerte erlebt hatte. Auf die Frage, ob und wann Rassismus einmal aufhören werde, antwortete Miles, der in seiner Musik nie eine Note zuviel spielte: “Dann, wenn ich in Malibu mit meinem Ferrari weiter als einen Strassenzug fahren kann, ohne von der Polizei angehalten und gefragt zu werden, wo ich das Auto geklaut hätte.”
Liebe Gabriele, eigentlich wollte ich Dir einen ganz anderen Brief schreiben. Ich wollte auf Deine treffenden Anmerkungen zur Gefahr des politischen Missbrauchs der Coronakrise antworten, denn ich glaube dass diese Problematik in Europa und den USA sich auf sehr unterschiedliche Weise manifestiert. Ich wollte Dir auch von einem wunderbaren Gedicht schreiben, das ich am Morgen jenes Tages las, als George Floyd ermordet wurde. Ich übersetzte es und schrieb einen kleinen Kommentar dazu. Aber all das muss warten. Der Brief, an dessen Ende Du jetzt angelangt bist, hat eine andere Tonlage. Ich brauchte lange, um ihn zu schreiben. Die Situation ändert sich täglich und manchmal im Stundentakt, und mit ihr das Nachdenken, das sengende, sich selbst nicht ausnehmende. Es bleibt nicht stehen, sondern verdichtet sich zu einer Beklommenheit, für die ich mitteilbare Worte suche.
Das Murmeltier ist seit drei Wochen verschwunden. Max Brod berichtet, dass Kafka einmal zu ihm sagte: “Es gibt unendlich viel Hoffnung –, nur nicht für uns.”
Herzlich,
Peter
24. Mai 2020
Lieber Peter,
der Flieder ist verblüht, jetzt ist es der Holder, der den Garten mit seinem Duft erfüllt. Immer, wenn ich in diese weißen Blütenkaskaden schaue, sehe ich auch die Arbeit des Spätsommers vor mir. Die tiefblauvioletten Beeren, die vor Saft strotzen und meine Finger färben. Es gilt jetzt abzuwägen, wie viele der Blüten ich in Sirup verwandle, wie viele ich stehen lasse, um später Marmelade, Likör oder Wein aus den reifen Beeren zu machen. In dieser Abwägung berücksichtige ich auch die Menge an Beeren, die wir den Amseln gönnen, die sich im Übrigen auch an den Kornelkirschen, der Felsenbirne, den Beeren des Wilden Weines und später im Herbst an den gefallenen Äpfeln gütlich tun. Wenn mein Mann im Garten jätet, nähern sich die Amseln am Boden bis auf einen Meter. Sie haben gelernt, dass durch seine stille, unaufgeregte Tätigkeit Würmer für sie abfallen.
Und wenn ich mit meiner alten Dame bei ihr auf dem Balkon sitze, dann pfeife ich dem Amselmann. Es ist ein Vergnügen für sie, ihn immer antworten zu hören. Sie, die nie Zeit für die Natur oder den Garten hatte, hatte stets eine Vorliebe für Kunststoffblumen, da sie keiner Mühe bedurften. Vor vier Jahren habe ich begonnen, ihr diese Kunststoffbegonien, die sie noch am Dachboden hatte, auf das weiß lackierte Gusseisengeländer zu binden. So blüht es dort scheinbar vom Frühling bis in den späten Herbst. Ich habe aber auch Gewürze auf dem Balkon gepflanzt. Wir riechen an ihnen, wir verwenden sie für die Speisen und zur Dekoration derselben. Meine alte Dame gießt die Gewürze, eine kleine Aufgabe, die ihr den Rhythmus des Tages und auch der Jahreszeiten vermittelt. Irgendwann hat sie begonnen, auch die Kunststoffblumen zu gießen, und ich habe mich über ihre logischen Verknüpfungen gefreut. Und wenn sich Schwebfliegen, Bienen und Hummeln auf diesen falschen Blüten tummeln, dann frage ich mich manchmal, ob sie vielleicht weniger einer optischen Täuschung anheimfallen als vielmehr auf unser Verhalten reagieren: auf unseren zärtlichen Blick, auf unsere Fürsorge, auf unsere Freude. Was wissen wir schon wirklich?
An jenem Tag (29.04.2020), als ich morgens den ersten Brief an Dich abschickte, hörte ich die Nachrichten erst spät. Es wurden geleakte Sitzungsprotokolle der Regierung und ihrer Taskforce Corona veröffentlicht. Ihnen war zu entnehmen, dass der Kanzler am 12. März (vier Tage vor dem Lockdown), dem Termin der ersten Sitzung mit Experten, das Angstmotiv aufgreift, das einst in GB in Bezug auf eine Masernepidemie so ähnlich kreiert wurde. Die Angst vor Lebensmittelknappheit allerdings, sei den Menschen zu nehmen.
Die Kommunikation der Angst, dass Großeltern sterben könnten, fand breit in unseren Medien statt – und zwar auf eine relativ nette Art: „Ich schau auf dich“. Das konnte jeder verstehen und fast alle machten mit. Die Angst vor „Hunderttausend Toten“, die Spaltung der Menschen in „Lebensretter“ und „Lebensgefährder“ wurde aber erst ab 30. März kommuniziert, zu einem Zeitpunkt, als die Corona-Krise im Gesundheitssystem bereits überwunden war. Warum? Bereits am 13. März soll Dr. Allenberger (Agesexperte) gewarnt haben, man müsse ganz schnell von der Botschaft des „ganz gefährlichen Virus“ wegkommen, weil diese Botschaft kontraproduktiv sei und zu größeren Kollateralschäden führen könne, die weit über Covid-19 hinausgehen könnten. Sars-CoV-2 sei für über 80 Prozent der Bevölkerung nicht gefährlich. (Falter 20/20).
An dieser Stelle mache ich eine Pause. Ich weiß nicht recht, ob ich meine Gedanken und meine Fragen hier überhaupt ausbreiten soll. Wirst du daran interessiert sein? Ich bin keine Philosophin und auch keine Politikwissenschaftlerin und sehe nur auf kleine Ausschnitte der Welt. In den letzten Jahren habe ich diese Konzentration auf Details trainiert, um sie ähnlich der fraktalen Welt Mandelbaums in Form von Zeichnungen auf das Papier zu bringen. In den besten Stunden denke ich, dieses Tun sei eine Art Meditation, die die Evolution von Vertrauen abbildet. In der iterativen Wiederholung ein und desselben Zeichens geschehen, wenn man so will, „kleine Fehler“, die die Fortschreibung oder Fortzeichnung in minimal anderer Richtung beeinflussen. Im ersten Moment mag als Störfaktor erscheinen, was letztendlich zu einem interessanten Ganzen führt, weil es lebendig ist und als solches wirkt. Vermutlich schaue ich auf eine ähnliche Weise in die Gesellschaft. Ich schaue auf die vielen kleinen Gesten, die es vermögen, im Kleinen etwas zu verändern, das durch Wiederholung zum großen Ganzen gedeiht. Dieses, am Anfang der Coronakrise kommunizierte „schau auf Dich, schau auf mich“, konnte am Einzelnen im Sinne von Freiwilligkeit und Verantwortung andocken und sich wiederholen, und darum funktionierte es. Die abrupte Unterteilung der Menschen in Lebensretter und Lebensgefährder nahm sich wie ein ausgeleertes Tintenfass über meiner Zeichnung aus: Es wurde das gemeinsame Werk zerstört. Indem man jene Wenigen, die sich nicht an die Regeln hielten oder sich auch nur zufällig in nicht tolerierten Situationen aufhielten, beinahe zu Verbrechern an der Menschlichkeit hochstilisierte, stellte man Sündenböcke in die Welt.
Meine Wahrnehmung täuschte mich nicht. Mimik und Gestik des Kanzlers stimmten nicht mit der Botschaft überein. Ich habe mich in den letzten Wochen gefragt, weshalb er gegen den Rat der Experten gehandelt hat, denn es lagen zusätzlich an jenem 30. März bereits Daten der Mathematiker vor, die besagten, dass eine Beschränkung der Freizeitkontakte der Generation 65+ um 50 Prozent bereits eine Senkung der Severe Cases von Covid-19 von über 50 Prozent für die Gesamtpopulation bedeutet hätte. Ein milderer Weg wäre möglich gewesen.
Warum also handelte der Kanzler so? Weil Netanjahu, den er kontaktierte, dazu riet? Wie kann man ausgerechnet den Menschen um Rat fragen, dessen Gesundheitsminister öffentlich erklärte, dass das Coronavirus eine Strafe Gottes für Homosexualität sei? Wie kann man in einem Land nachfragen, in dem die Ultraorthodoxen, die sich nicht an Ausgangsbeschränkungen halten, die eigene Polizei als „Nazis“ beschimpfen und sie mit uringefüllten Plastiksäckchen bewerfen?
Der Kanzler hat sich nicht verrechnet, wie ich im ersten Brief an dich anklingen ließ. Er hat ge-rechnet, wie ich vermute: Wenn er die Krise verschärft kommuniziert, so wird er nachher umso besser dastehen. Dann hat er hunderttausend Menschen gerettet und nicht wir, die wir uns solidarisch und empathisch verhalten haben. Diese meine Annahme entspräche seiner dummen Eitelkeit, die er im Kleinen Walsertal unter Beweis stellte. (Aber das ist eine andere Geschichte, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will, sie hat aber dazu geführt, dass kurzfristig seine Umfragewerte gesunken sind und sich viele Menschen nicht mehr an die Maskenpflicht halten wollen.)
Auf jeden Fall hat er uns mit dieser Angstkommunikation ab 30. März um unsere Freude gebracht, dass unser Handeln bzw. Nichthandeln sich sehr positiv auf das Verflachen der Kurve (flatten the curve) ausgewirkt hat – er hat stattdessen mit seinem Innenminister dem Moralismus und der Denunziation Tür und Tor geöffnet. Das halte ich für gefährlich. Das sind Wege, die wir schon einmal gegangen sind – sie wurden in der kollektiven Erinnerung wachgerufen. Eine Folge davon ist, dass Rassismus und Antisemitismus deutlich zugenommen haben.
Dazu kommt, dass das Epidemiegesetz ausgehebelt wurde und die Milliardenpakete an Unterstützungen ausgerechnet von der Wirtschaftskammer verteilt werden. Die Großen, die den Wahlkampf des Kanzlers unterstützt hatten, werden jetzt mit zukünftigen Steuergeldern gefördert, obwohl sie gleichzeitig Dividenden ausschütten, während die unendlich vielen EPUs und KMUs zu Bittstellern degradiert wurden und viele von ihnen noch immer leer ausgehen. Die Umverteilung von unten nach oben nimmt deutlich zu. Vom Umgang mit den Künstlern ist ganz zu schweigen, die wurden schlicht vergessen. Und ich kann mich des Gedankens nicht verwehren, dass in der Kultur eine Art Flurbereinigung stattfindet, die auch vom ORF mitgetragen wird: In Vorarlberg wurde letzthin ein Kulturredakteur aus fadenscheinigen Gründen gefeuert, während in Wien ein Jahr nach Ibiza, ich fasse das eigentlich nicht, dem Herrn Strache wieder eine mediale Bühne geboten wird. Zudem wird über die Wirtschaftskammer Werbung für unsere Boulevardpresse vertrieben, an denen ein dem Kanzler nahestehender Milliardär beteiligt ist. Man wird in Zukunft nicht mehr von Volksgesundheit sprechen müssen, wenn man der Volksverblödung derart viel Vorschub leistet.
Dazu passt, dass der Bildungsminister beifällig den Satz fallen lässt, dass in den nächsten Jahren mehrere private Universitäten entstehen sollen. Ich stehe dem zwiespältig gegenüber. Wer wird das finanzieren? In welche Richtung wird die Forschung ausgerichtet? Vorletzte Woche habe ich einen Bericht der Montanuni Leoben über die ersten Doktorarbeiten zum Thema Bergbau am Mond gelesen. Wie stolz man auf diese „Errungenschaften“ ist – während man für die öffentlichen Schulen so nebenbei den in Diskussion stehenden verpflichtenden Ethikunterricht strich, und stattdessen das Fach „Religion“ zum Wahlpflichtfach erhob.
Und dazu kommen die vielen arbeitslosen, eh schon mittellosen Menschen, von denen wir hochmütig annehmen, dass sie auf die Populisten hereinfallen und in Zukunft noch mehr hereinfallen werden. Und gleichzeitig wird Österreich aufgrund seines hervorragenden Gesundheitssystems, das sich in der Pandemie bewährte, plötzlich relevant für die Superreichen – man liest, für einen österreichischen Pass zahlen sie bis zu sieben Millionen Euro. Voraussetzung für den Pass ist nur, „dass man sich um die Republik verdient macht“. Man muss es sich leisten können, Österreicher oder Österreicherin zu sein, die Einbürgerungen sind in den letzten Jahren drastisch gesunken, sie sind einkommensabhängig. An dieser Stelle mag ich gar nicht mehr weiterschreiben, was ich weiterdenke.
Dazu kommt auch noch, dass ein Ökonom aus dem Umfeld der Industriellenvereinigung die Leitung der Statistik Austria übernommen hat und vorab alle neuen Aussendungen zuerst ans Bundeskanzleramt schicken muss. Message control. Evidenzbasierte Politik in Echtzeit aufgrund statistischer Auswertung unserer digital erfassten Aktions- und Reaktionsmuster ist das Ziel.
Bazon Brock hatte vermutlich recht. Nach einer solchen Krise driftet eine Gesellschaft nach rechts. Das stimmt mich absolut dystopisch. Naomi Kleins Text im Guardian „How big tech plans to profit from the pandemic“ tut sein Übriges dazu. Die bewusst geschürte Angst und der Moralismus (die anderen sollen sich an die Regeln halten) werden dazu führen, dass Menschen JA zu allen möglichen Überwachungssystemen sagen werden.
*
Lieber Peter, zu Beginn dieser Krise hatte ich ehrlich gehofft, dass diese Lockdowns dazu führen könnten, dass Gesellschaften dauerhaft umzudenken fähig wären (wenn ich mir auch schwere Sorgen um die Schwellenländer machte, in denen so viele Menschen von der Hand in den Mund leben – den Verzweiflungsschrei eines Beiruter Straßenhändlers vergesse ich nie). Ich habe nachgeschaut, wann ich meine Haltung zu unserem Lockdown geändert habe. Es war der 5. April. Zu diesem Zeitpunkt haben Schweizer Ärzte bereits Alarm geschlagen, dass es 40 % weniger Herzinfarkte gäbe, dass Patienten nicht mehr in die Ordinationen kämen. Ich habe das verfolgt und ganz ähnliche Berichte von österreichischen Ärzten gefunden. Auch in der englischen Presse schlugen damals schon Ärzte Alarm, dass Menschen mit schweren Erkrankungen aus Angst vor Corona nicht mehr die Spitäler aufsuchten, dass sie zu Hause blieben und dort starben.
Ich habe mich damals gefragt, wie viele neue Krankheitsfälle und auch Todesfälle wir durch den Stress der Isolation, durch den Stress, den Panik verursacht, durch den Stress, den Arbeitslosigkeit verursacht, schaffen. Da kein Grundeinkommen verteilt wurde (was m.E. sinnvoll gewesen wäre), fand ich diese Fragen berechtigt. Ich habe das weniger als „Rechnen“ empfunden, vielmehr als „Abwägen“. Es galt und gilt, die alten und schwachen Menschen zu schützen. In meiner Sicht hatte sich aber die Gruppe der „schwachen“ Menschen verändert – Frauen und Kinder, die häuslicher Gewalt und Missbrauch ausgesetzt waren, suizidgefährdete Menschen, Menschen, die auf Krebsdiagnosen warteten, usw. Ich hatte die Frage so gestellt: Schaffen wir durch den Lockdown neue Risikogruppen? Ich stellte diese Frage auch vor dem Hintergrund, dass mehrere Ärzte erzählten, die für Covid-19 ausgerüsteten Krankenhäuser stünden fast leer.
Jetzt werden abertausende verschobene Operationen allmählich nachgeholt. Zwanzigtausend Psychotherapieplätze werden zusätzlich geschaffen, um die in der Zeit des Lockdowns an der Psyche Erkrankten aufzufangen – Depressionen sind von 4 auf 20 % gestiegen, Angstzustände von 5 auf 19% und Schlafstörungen sind auf 19 % gestiegen (Donauuniversität Krems). In Deutschland untersuchen Pathologen die durch die Angst vor Corona verübten Suizide und von San Francisco lese ich Ähnliches. Die Studie (an der auch Dr. Drosten beteiligt war), die besagt, dass 30-40% der mit Sars-Cov-2-Infizierten eine gewisse Kreuzimmunität (zelluläre Immunität) mit anderen Coronaviren aufweisen und deshalb keine Symptome zeigen, liegt nicht länger unbeachtet auf einem Preview-Server, sie gelangt langsam an die Öffentlichkeit und nimmt hoffentlich etwas von der Panik.
Diese umfassendere Sicht auf eine momentane Pandemie plus ihrer möglichen Folgen aufgrund von Maßnahmen gegen sie, ist vermutlich jene, auf die Anders Tegnell mit seiner Strategie in Schweden baute. Ich kann nicht glauben, dass es in Schweden nur um die Wirtschaft ging. Denn Schweden hat zur Zeit der Schweinegrippe Erfahrungen gemacht, die uns in Österreich, soweit ich weiß, erspart blieben. Tegnell war damals für Massenimpfungen eingetreten, die, wie sich danach herausstellte, lebenslange Folgeschäden für 168 Kinder hatte, da sie eine Narkolepsie entwickelten. Also nahm ich an, dass er viele Bedenken gegeneinander abwog.
Ich habe öfter mit Interesse aber auch mit Besorgung nach Schweden geschaut. Was mir persönlich auffällt, da ich mich in der Vergangenheit aufgrund meiner Beteiligung an Visionsprozessen ein bisschen mit pflegerischen Modellen in den nordischen Staaten auseinandergesetzt habe, ist, dass in Schweden wesentlich mehr junge Menschen (Studenten) an der Betreuung alter Menschen mitwirken als bei uns. Was uns vor ein paar Jahren noch eine Art Vorbild war, dass Studenten auch Tür an Tür mit alten Menschen leben, ist vielleicht jetzt in Schweden zum Damoklesschwert geworden. Aber nicht nur dort, die Zahl der Todesfälle in Altersheimen ist in Belgien (vor Spanien und Italien) und den Niederlanden ähnlich hoch, wenn nicht höher.
Das ambulante Modell der Altenpflege (Buurtzorg, von Jos de Blok 2007 gegründet) in den NL ist ein Vorzeigemodell. Ich kann aber momentan keine Aussage finden, wie es sich in der Coronakrise bewährt hat.
Diese Pflegemodelle würden mich nicht nur aufgrund meiner eigenen Tätigkeit mit meiner alten Dame interessieren und im Hinblick auf die Entwicklung der Pflege hier im Land, sondern auch in Erwartung des eigenen Altwerdens. Und das wiederum führt dazu, dass ich mir Gedanken über den eigenen Tod mache. Seltsamerweise ist daraus Kraft zu schöpfen.
Der Zufall will, dass ich jetzt in diesem Moment das Titelblatt der New York Times vom heutigen Tag betrachte. Ich lese die Namen und die kleinen Lebensgeschichten von tausend an Corona verstorbenen Menschen, die hier stellvertretend für Hunderttausend veröffentlicht sind.
Ich erinnere mich an Cambridge. Als ich dort vor einigen Jahren Wittgensteins Grab suchte, blieb ich an einem Grabstein stehen, in den vorne und hinten die Daten von Verstorbenen eingeprägt waren. Vorne war der Satz zu lesen: She had done what she could. Ich stand lange dort, und versuchte mir vorzustellen, wie das Leben dieser Frau ausgesehen haben mag. Sie tat, was sie konnte. Hat man sie gemocht? Oder war sie eher eine schwierige Person, der man im Tod bescheinigte, dass sie sich wenigstens bemüht hatte? Für mich war diese Zusammenfassung eines ganzen Lebens in einem einzigen Satz neu. Ich mochte das und dachte, dass ausgerechnet dieser Satz einmal auf meinen Grabstein passen würde.
Und so bin ich tief berührt von diesen vielen gewesenen Leben in New York, die sich nach ihrem Tod noch über einen einzigen Satz in mein Herz zu schreiben vermögen. Der Mann, der seinen Beruf aufgab, um sich um seine Eltern zu kümmern. Der Mann, dessen größte Errungenschaft die Beziehung zu seiner Frau war. Die Großmutter, die voller toller Ideen war. Sie alle sind wir.
They are us.
Ich weiß nicht, ob dieses Bewusstsein sich durchzusetzen vermag. Aber als ich am vergangenen Freitag mit Freunden am See entlang geradelt bin, habe ich viele freundliche Menschen gesehen, die sich ganz offensichtlich freuten, zu grüßen. Allen war Erleichterung ins Lächeln gewoben und doch hielten sie sich noch an den obligatorischen Abstand. In der Stadt war ich noch nicht unterwegs, davon kann ich nicht erzählen.
Ich kann dir aber von meiner Anfang Mai getroffenen Entscheidung berichten. Ich werde weiter für meine alte Dame tätig sein, werde weiter Rücksicht und Vorsicht walten lassen. Insofern habe ich die Lockerungen im Alltag hier gar nicht mehr mitverfolgt. Für mich wird sich in den kommenden Monaten nicht viel ändern, wie schon zuvor nicht. Meine slowakische Kollegin kann nun nach drei Monaten nächste Woche wieder nach Hause fahren. Sie war hiergeblieben, weil sie in der Slowakei nicht in staatliche Quarantäne gehen wollte. Sie freut sich sehr und ich mich mit ihr. Die Suche nach einem Arzt, der einen Covid-Test an ihr durchführt, den sie für die Einreise in die Slowakei benötigt, war aber ein kleineres Abenteuer, was mich wiederum verblüffte. Ich dachte, die Vorarlberger seien besser organisiert.
Was ich der soeben eintreffenden Analyse (ich sitze am Computer im Büro) eines politisch analysierenden Journalisten entnehme, gibt unser Kanzler jetzt das Schlagwort „Eigenverantwortung“ aus. Österreich könne sich keinen zweiten Lockdown leisten, die Arbeitslosigkeit sei höher als in Deutschland und der Schweiz. Man müsse sich, wie es auch in der Schweiz gefordert werde, mehr am Modell Schweden orientieren. Die Zahl der Todesfälle halte sich dort auf einem Niveau, das einer schwereren Grippewelle in Österreich entspricht.
Nun, es ist ohnehin müßig, darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn. Und dennoch könnten wir jetzt doch einiges lernen, weil das vermutlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird.
Das Wichtigste scheint mir, dass man niemanden zurücklassen darf. Leave no one behind. Nicht den Geringsten darf man zurücklassen, so auch nicht die geflüchteten Menschen, die in Lagern verharren müssen, nicht die Sklavenarbeiter (Erntehelfer, Arbeiter in Schlachthöfen usw.) in ihren unmenschlichen Unterbringungen, niemanden. Denn jeder Vergessene kann durch nicht erkannte Ansteckung eine neue Welle an Krankheit und Tod hervorrufen. Wenn das nicht aus Empathie heraus verstanden werden kann, so doch wenigstens aus einem kollektiven Egoismus heraus. Das gilt weltweit. Die Prävention bestünde also darin, ordentliche Löhne zu zahlen, gesunde Ernährung anzubieten und für gesundheitliche Leistungen auch außerhalb der Krise zu sorgen.
Und wer soll die Kosten dafür tragen?
Das Geld muss man von den Superreichen holen. 3% des Geldes jener 400 reichsten Amerikaner, die Du erwähntest, würden ausreichen, um alle Amerikaner auf Corona zu testen. Mit diesen 3% könnte man aber auch weltweit die Malaria besiegen, die im 20. Jahrhundert mehr Tote (vor allem Kinder) forderte als die Schwarze Pest. Und so fort.
Ja, ich bin absolut geneigt, ab sofort sämtliche Regierungen, die nicht endlich die Konzerne besteuern und Finanztransaktionssteuer einführen, als verbrecherisch zu bezeichnen.
*
Lieber Peter, als dein Brief ankam und ich von Deinem Murmeltier las, musste ich schmunzeln. Dein Murmeltier ist hier der Igel. Ich sah ihn, als ich nächtens noch auf dem Balkon saß. Ich freue mich über ihn, habe mich aber dennoch vergewissert, dass der Zaun des Hühnergeheges keine Durchschlupfmöglichkeit für ihn bietet. Letztes Jahr hat er sich derart in eines unserer Hühner verbissen, dass wir ihn nur mit einer Kaltwasserdusche zum Loslassen bewegen konnten. Das Huhn ist leider gestorben.
Zu unseren Hühnern gesellt sich seit einer Woche auch eine geschenkte Ente. Es ist jetzt ein fröhliches Gemisch aus Schnattern und Gackern tagsüber in unserem Garten zu hören. Abends geht es allmählich in das Zirpen der Grillen über, mein liebster Hauch von Süden.
In diesen Tönen liegt Frieden für mich.
Ich freue mich, dass es euch gut geht, dass Deine Mutter so gut versorgt ist, dass meine Tochter in Portugal zum ersten Mal einen Ausflug machen konnte, und dass meine Tochter in Wien, die ursprünglich nach Lissabon fliegen wollte, jetzt ab Anfang Juni ihren Urlaub bei uns verbringen wird. Ich freue mich, dass zwei meiner Söhne sich fragen, wie sich ein gutes Leben nach der Coronakrise gestalten lässt. Sie haben die Idee geboren, gemeinsam mit Freunden den brachliegenden Acker zu bestellen, und so werden wir im kommenden Jahr viel zu studieren und vorzubereiten haben.
Und ich freue mich, dass meine Eltern relativ sorgenfrei über diese Zeit gekommen sind und meine lungenentzündungsanfällige Pflegeschwester, die sie seit bald vierzig Jahren betreuen, gut behüten konnten. Das Geburtstagsfest zum Vierziger, den sie im April gefeiert hätte, wird jedoch wohl noch weiter in die Zukunft verschoben werden müssen.
Jetzt, da die Welt sich wieder öffnet, kann ich in meine eigene Stille zurückkehren, die auf eine etwas verschrobene Art jenem schiefen Haus im Garten des Fürsten Orsini in Bomarzo gleicht: erst im Verlassen desselben wurde mir schwindlig.
So schicke ich Dir aus diesem Beginn einer neu zu erobernden Stille meine besten Wünsche für Dich und Deine Familie
und grüße Dich herzlich,
Gabriele
20. Mai 2020
Liebe Gabriele,
meine Antwort auf Deinen Brief ließ lange auf sich warten. Das hat zwar mit den Auswirkungen der Coronakrise zu tun, aber es gibt in unserem Fall keinen Anlass zu Sorge. Wir halten uns seit zwei Monaten in unserem Haus auf und machen nur ab und zu einen kleinen Spaziergang. Diese Woche ist das Wetter besser geworden, nachdem es Anfang Mai noch zweimal schneite. Alles im Garten blüht. Die Bäume, die letzte Woche noch kahl waren, tragen mittlerweile Blätter, die man fast beim Wachsen beobachten kann. Jeden Abend, wenn ich zum Küchenfenster hinausschaue, wird die Waldwand undurchdringlicher.
Schon beim ersten Lesen Deines Briefes wollte ich so manche Bemerkung dazwischenwerfen: etwa dass ich mit den Herausforderungen der Pflegefrauen, die sich um alte und demente Patienten kümmern, vertraut bin. Meine Mutter, die in Liechtenstein lebt, wird seit gut zwei Jahren abwechselnd von verschiedenen Pflegerinnen betreut. Alle von ihnen kommen aus osteuropäischen Staaten. Die meisten haben ihre eigenen Familien, die sie unter normalen Umständen nur alle drei Wochen zu sehen bekommen und jetzt, aufgrund der verschärften Lage, sogar nur alle sechs Wochen. Die jetzige Betreuerin sagte mir letzte Woche am Telefon, dass sie nun jeweils vor Dienstantritt im Landesspital Vaduz einen Covid-19-Test machen müsse. Das sei die neue Vorschrift, um die betreuten Menschen zu schützen. Obwohl dieses Erfordernis ihr zusätzliche Umstände bereitet – ich vermute, dass sie fast einen Arbeitstag dadurch verliert, da sie kein eigenes Auto besitzt und auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist –, beklagte sie sich mit keinem Wort. Ganz im Gegenteil: Sie lobte die Maßnahme, weil dadurch die Schwächsten geschützt würden. Und diese Frau, die ich nur als Telefonstimme mit slawischem Akzent kenne, sagte mir auch sehr eindringlich, dass ich mir keine Sorgen um meine Mutter machen müsse.
Liebe Gabriele, ich vermute, Du wirst mich verstehen, wenn ich Dir schreibe, dass ich in diesem Moment gerührt und zugleich erschüttert war: gerührt von der tatkräftigen Sorge, die aus den Worten dieser Frau sprach, und erschüttert, weil ihre anpackende Hilfsbereitschaft sich so deutlich abhebt von der Empathieermüdung, die nach Wochen des sogenannten Lockdowns allenthalben zu beobachten ist. Schlimmer noch als die rasch aufgebrauchte Solidarität ist ein allgemeiner Mangel an Fantasie. Waren am Anfang der Krise noch zahlreiche Stimmen im öffentlichen Diskurs zu vernehmen, die darauf pochten oder wenigstens darauf hofften, dass es nach der Bewältigung dieser enormen Herausforderung keine einfache Rückkehr zur gesellschaftlichen und politischen Normalität geben könne, so scheint sich das Blatt allmählich zu wenden. Das liegt auch und vielleicht sogar vor allem daran, dass sich die Diskussion zunehmend um eine unselige Kostenrechnung dreht, die Menschenleben und wirtschaftliche Verluste miteinander verrechnet, als wäre unsere Wirtschaftsordnung ein unabänderliches Naturgesetz. Als wären die ohnehin Alten und Schwachen den Preis ihrer Rettung nicht wert.
Hier ist eine einfache Frage, die sich ohne Mut und Fantasie nicht zufriedenstellend beantworten lässt: Handelt es sich bei der ganzen Angelegenheit wirklich um ein Nullsummenspiel zwischen den für die Krankheit Anfälligen und denjenigen, die am meisten an den wirtschaftlichen Folgen zu leiden haben – den Kleinunternehmern, den Selbständigen, den Arbeitnehmern, die um ihre Stelle fürchten oder sie schon verloren haben oder wie hier in den USA kräftige Lohnabstriche in Kauf nehmen müssen?
Und gleich noch eine weitere Frage: Wie kann es sein, dass in der Anfangsphase der Coronakrise in Amerika, das Vermögen der US-Milliardäre in nur 23 Tagen, vom 18. März bis zum 10. April, um 9.5% oder 282 Milliarden Dollar anstieg, während gleichzeitig 22 Millionen Amerikaner arbeitslos wurden (mittlerweile sind es über 36 Millionen), von denen viele mit der Stelle auch ihre Krankenversicherung verloren? Jeff Bezos, Gründer von Amazon und derzeit reichster Mensch auf Erden, darf sich einen neuen Geldspeicher bauen, denn seit Anfang Jahr hat sich sein Vermögen um märchenhafte 25 Milliarden vermehrt. Ich wage zu sagen: fast ohne sein Zutun. (Diese Zahlen entnehme ich übrigens nicht irgendeinem revolutionären Manifest, sondern einer Meldung vom 1. Mai auf der Webseite businessinsider.com, die zur für konservative und gutbürgerliche Leser unverdächtigen Axel-Springer-Verlagsgruppe gehört.)
Es passt zu dieser Geschichte, dass Whole Foods – eine gehobene Supermarktkette, die 2017 von Amazon, dieser über alle Maßen erfolgreichen Firma, die keinen Dollar Steuern bezahlt, übernommen wurde – seine Angestellten schon im März dazu aufforderte, die ihnen zustehenden bezahlten Ferien ihren erkrankten Kollegen zur Verfügung zu stellen, damit diese der Arbeit fernbleiben dürfen. Auch wenn solche Zustände in Europa noch nicht denkbar sind, ist die ihnen zugrunde liegende Logik auch drüben längst allgegenwärtig. Denn auch innerhalb der europäischen Staaten gibt es einen Umgang mit dem Krankheitsrisiko, der bestehende soziale Ungleichheiten verstärkt und auf eine zweigeteilte Gesellschaft hinausläuft: Auf der einen Seite gibt es die Schützenswerten, die zu den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Eliten gehören und die zum Teil sogar von der Krise profitieren. Auf der anderen Seite stehen die Verlierer, die Minoritäten, die Flüchtlinge, die Ungebildeten, die Arbeitslosen, die Behinderten – alle die im gesellschaftlichen Wettbewerb von Anfang an benachteiligt waren und den Anschluss verloren haben. Die besondere politische Tragödie besteht darin, dass viele dieser Habenichtse sich noch immer zum Mittelstand gehörig wähnen und sich von den falschen Versprechungen und Verschwörungstheorien populistischer Politiker verführen lassen. Fast ohne es zu merken, verfallen sie dem neuen Faschismus und tragen ihn immer weiter in die gesellschaftliche Mitte, wenn sie anderen Benachteiligten – gestern waren es die Flüchtlinge, heute sind es die Alten und Kranken – die Solidarität aufkündigen, in der Hoffnung aus dem Verteilungskampf um die wenigen Almosen der Regierung selbst als Sieger hervorzugehen.
Noch etwas anderes stört mich an den vielen öffentlichen Protesten gegen die von den Regierungen verordneten Maßnahmen: In Ländern wie Deutschland oder Österreich führen lautstarke Kritiker die relativ niedrigen Infektions- und Todesraten als Beweis dafür an, dass die ganz Krise aufgebauscht sei und vor allem dazu diene, die Bevölkerung durch Notrechtsverordnungen zu entrechten. Um solche Skeptiker von ihrem Irrtum zu überzeugen, bräuchte es ein Alternativuniversum, in dem nichts gegen die Verbreitung von Covid-19 unternommen worden wäre. Erst das volle Ausmaß der Katastrophe würde die Kritiker widerlegen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass solche Alternativszenarien tatsächlich existieren, wenn auch in begrenzterem Rahmen: In Norditalien und New York City, zwei der am schwersten heimgesuchten Orte, kamen die Schutzmaßnahmen zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Ich werde die Bilder von Massengräbern in New York nie vergessen. Zugleich setzt Schweden bewusst auf Herdenimmunität und nimmt dafür den Tod von Tausenden in Kauf, in der Hoffnung, bei späteren Ausbrüchen viele Todesfälle verhindern zu können. Das mag plausibel klingen. Doch die Strategie ist unter Fachleuten umstritten. Die überwiegende Mehrheit der Virologen glaubt nicht an ihren Erfolg. Es sind allerdings nicht allein diese fachlichen Einwände, die mich nachdenklich stimmen. Es ist etwas Grundlegenderes: Ich kann mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass ganze Bevölkerungsgruppen ungefragt einem vermeidbaren Risiko ausgesetzt werden sollen zum Wohle der Jüngeren und Gesünderen und wohl auch Reicheren. Sind die Leben der Alten und Schwachen weniger wert?
Es ist, als ob ein Rettungsschwimmer am Flussufer tatenlos zusähe, wie ein Schwimmer ertrinkt, nur weil er vermutet, dass er demnächst zwei andere wird retten müssen. Würden wir diesen Bademeister für seine Weitsicht loben? Was, wenn es ihm später tatsächlich gelänge, zwei andere in Not Geratene zu retten, weil er noch frisch und auf seinem Posten ist? Würden wir ihm die besondere Kaltblütigkeit, die es brauchte, um den ersten Schwimmer ertrinken zu lassen, hoch anrechnen? Würden wir wollen, dass ein solcher Bademeister über unser Leben wacht?
Es sind solche Rechnungen, die mir nicht aus dem Kopf gehen. Ich nehme nicht in Anspruch, es besser zu wissen, und glaube, dass es fatal ist, wenn wir hier allzu schnell in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Ich zweifle nicht daran, dass auch die schwedischen Behörden nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, medizinisch gute und moralisch vertretbare Entscheidungen zu fällen. Erst am Ende wird sich zeigen, wer die beste Bilanz hat. Was mich aber bedrückt, ist gerade dieses Rechnen, die Rede von der Bilanz, das ökonomische Denken, das darüber bestimmt, was dieses oder jenes Leben wert sein soll. Ohnehin wird in unserer durchökonomisierten Gesellschaft zu oft Wert als bloßer Preis missverstanden. Was uns dies oder jenes kostet, ist aber eine ganz andere Frage als: Was ist es uns wert?
Ich weiß, dass die Frauen, die meine Mutter betreuen, sich sehr um sie kümmern. Sie tun ihr gut, weit über die eigentliche Hilfe hinaus. Es gab die eine oder andere, die den Job nicht lange machen konnte, weil er zu anstrengend und aufreibend ist. Oder weil sie Heimweh nach ihrer eigenen Familie hatte. Diejenigen, die nach dem ersten Einsatz wieder gekommen sind, haben alle etwas Resolutes und zugleich Herzliches. Sie erzählen meiner Mutter von ihren Familien, von der Landschaft und vom Essen bei ihnen zuhause. Wenn es innerhalb Europas kein dramatisches wirtschaftliches Gefälle gäbe, könnten die meisten Betreuten sich diese Hilfe nicht leisten. Ähnliches gilt in fast allen Pflegeberufen. Die Covid-19-Krise hat das deutlich gemacht. Man spendet den Krankenpflegern, Ärztinnen und Betreuerinnen Beifall und lobt sie als Heldinnen unserer Zeit. Ob dies etwas an ihrem Status und dem Gesundheits- und Pflegesystem insgesamt ändern wird, sobald die Krise vorüber ist, wird sich zeigen. Ich vermute, dass die während des Lockdowns gewonnenen Einsichten, als die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen auf sich gestellt und gezwungen waren, über die alltäglichen Abläufe, die plötzlich nicht mehr spielten, nachzudenken, sich bald nach der Normalisierung wieder verflüchtigen werden. Schon jetzt wollen die meisten nichts mehr, als sich wieder dem Vergnügen hingeben zu können. Nicht dass daran etwas falsch wäre. Ich gebe zu, dass auch ich mir die Rückkehr unbeschwerter Lebensfreude wünsche, die sich zur Zeit irgendwo im Dunkeln verkrochen hat. Doch muss eins das andere ausschließen? Könnte nicht die wiedergewonnene Freude uns dazu bewegen, unsere Prioritäten zu überdenken und für mehr Gerechtigkeit einzustehen?
Es könnte sein, dass diese Krise noch lange nicht ausgestanden ist oder dass es in einem Auf-und-Ab immer wieder neue Infektionswellen geben wird. An meiner Universität ging letzte Woche das Frühlingssemester zu Ende. Prüfungen und Abschlussarbeiten stehen noch aus. Alles findet seit Mitte März auf virtuelle Weise statt. Schon seit ein paar Wochen steht fest, dass in diesem Jahr Sommerkurse, -konferenzen und alle sonstigen Veranstaltungen, Konzerte, Aufführungen und Ausstellungen ausfallen werden. Wie im Herbstsemester Vorlesungen und Kurse abgehalten werden sollen, steht noch in den Sternen. Alle paar Tage erhalten wir von höherer Stelle eine Zusammenfassung der neuesten Maßnahmen und Beschlüsse. Dabei werden auch die Konkurrenzinstitutionen genau beobachtet.
Einzelne Universitäten haben bereits angekündigt, im Herbst ganz auf den Präsenzunterricht zu verzichten. Andere haben die Krise zum Vorwand genommen, um unrentable Abteilungen (oder was dafür gehalten wird, nicht immer mit guten Gründen) zu schliessen und die Personalkosten durch Entlassungen soweit zu reduzieren, dass sie die erwarteten finanziellen Einbußen im Herbst auffangen können. Es zeichnet sich ab, dass viele angehende Studenten davon absehen werden, in diesem unguten Jahr ihr Studium zu beginnen. Manche unter den Fortgeschritteneren werden ein Zwischenjahr einlegen, denn wer will schon die hohen Studienkosten – an den führenden Privatinstitutionen mittlerweile mehr als 50’000 Dollar pro Jahr – für besseren Fernunterricht bezahlen?
Man kann davon ausgehen, dass dieser Geschäftseinbruch längerfristig eine große Anzahl von Universitäten ruinieren wird. Eine Hochschulbildung wird ein exklusiveres Gut werden, und das schon heute im amerikanischen Bildungssektor sehr ausgeprägte Kastensystem wird sich weiter verfestigen. All diese Tendenzen würden sich exponentiell verstärken, falls das social distancing über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden müsste oder wenn es eine massive zweite oder gar dritte Corona-Welle mit entsprechenden Lockdowns geben sollte. Vielleicht wird 2020 einmal als das Jahr gelten, in dem die klassische Universität zu existieren aufhörte. Auflösungserscheinungen wie die fortschreitende Digitalisierung, die Übernahme der Bildungsinstitutionen durch Manager und profitorientierte Firmen und das fehlende politische Bekenntnis zu einer qualitativ hochstehenden Bildung für alle gibt es zwar schon länger. Allerdings wirkt sich die gegenwärtige Krise wie ein Brandbeschleuniger aus.
Liebe Gabriele, wären wir mitten im Gespräch, anstatt uns Briefe zu schreiben, dann gäbe es jetzt eine Pause. Ich wäre für einen Moment mit meinen Gedanken allein.
Am Computer sitzend schaue ich auf und blicke in den Garten hinaus, wo seit zehn Tagen der Kirschbaum prächtig blüht, direkt vor meinem Fenster. Vor ein paar Tagen sprang einen ganzen Vormittag lang ein Goldzeisig zwischen den hellrosa Blüten von Zweig zu Zweig. Sein gelbes Gefieder leuchtete auf, wenn er aus dem Schatten ins Licht hüpfte. Gestern war es ein Baltimoretrupial (ich musste den deutschen Namen nachschlagen), ein in Nordamerika recht weit verbreiteter Vogel, den ich zuvor noch nie bemerkt hatte. Seine Unterseite war von leuchtendem Orange, das je nach Lichteinfall eher ins Gelbe oder Rote changierte. Mein vierjähriger Sohn hatte ihn in unserem Baum entdeckt und rief mich aufgeregt ans Fenster, wo wir dem Vogel lange zusahen.
Auch das Murmeltier ist seit meinem letzten Brief jeden Morgen und Abend in unseren Garten gekommen. Vor ein paar Tagen bemerkten wir, dass es am Rücken eine Wunde hat, die aber schon wieder langsam verheilt. Es könnte ein Streifschuss gewesen sein oder der Biss eines größeren Tiers, vielleicht eines Kojoten oder eines Hundes. Man sieht die Murmeltiere hier vor allem als Schädlinge, weil ihr Bau recht ausgedehnte Dimensionen annehmen kann. Ihre Grabungen richten in manchen Gärten Verwüstungen an und können sogar das Fundament eines Hauses destabilisieren. Man würde mir wahrscheinlich mit Unverständnis begegnen, wenn ich erzählte, dass ich das Murmeltier in unserem Garten nicht nur dulde, sondern mich jeden Tag auf sein Erscheinen freue. Genau zu der Zeit, als wir uns wegen des Virus in unsere Häuser zurückziehen mussten, erwachte es aus seinem Winterschlaf und hatte vielleicht seinen schönsten, weil ungestörtesten Frühling seit langem. Ich wünsche mir, dass seine Wunde gut verheilt und dass es uns noch oft besuchen wird. Es ist mein Wappentier geworden, ein Zeichen der Hoffnung: dass es auch für uns Menschen wieder einen besseren Frühling geben möge.
Mit herzlichen Grüssen aus Ithaca, N.Y.,
Peter
Hohenems, 26. April 2020
Lieber Peter,
es ist schön, in diesen Zeiten ein Du geschenkt zu bekommen. Dieses Du ist mir wie eine Biene auf dem leuchtenden Löwenzahn, der jetzt zu verblühen beginnt. Bienen sind kostbar geworden. Ich habe heute gelesen, dass diese weltweiten Shutdowns den Transport der Bienenvölker zwischen den Ländern verhindern. Ein Bild aus China kommt mir in den Sinn: Menschen in weißen Schutzanzügen bestäuben die Blüten der Bäume von Hand. Menschen in weißen Schutzanzügen sind es auch, die jetzt andere Menschen untersuchen, behandeln und heilen. Die beiden Bilder überlappen sich in meinem Kopf und werden eins.
Dein Du ist mir auch ein neuer Weg unter Wegen, deren wenige private oder kulturelle, die ich in der materiellen Welt noch zu gehen pflegte, man mir nun mit dem Shutdown genommen hat. Ich vermisse das Lachen in einer Theatervorstellung, das durch Betroffenheit ausgelöste Schweigen, das Verbindende in der Trennung, sich einmal jenen und dann wieder anderen zugehörig zu fühlen.
Ich vermisse die Umarmungen meiner Freunde. Die seltenen Momente, in denen ich einen von ihnen treffe, weil ich etwas vorbeibringen muss, stehen wir maskiert vor der Haustüre, lächeln uns beschämt zu und halten zwei Meter Abstand voneinander, weil dies das Maß ist, das die mit 40 kmh vorbeifahrende Polizei vom Auto aus als tolerierbar diagnostiziert. Die Strafen, von oben verordnet, sind drakonisch. Ob es hier, im Weg unseres Briefeschreibens, auch eine Selbstverordnung zur Maskenpflicht und zum Abstandhalten geben wird, da wir wissen, dass unsere Briefe veröffentlicht werden?
Das ist eine Frage, die ich mir seit Zusage zu diesem Projekt „Cara Roberta“ stelle. Ergo habe ich für mich beschlossen, meine persönlichen Zusagen, Absagen, mein Versagen auch, das viele Nicht-Sagen und das Einsagen von außen durch kolportierte Bilder zu beschreiben. Ich kann dir nämlich nicht viel von draußen berichten, da ich nicht viel unterwegs bin. Ich sitze in diesem Moment auf dem Balkon und blicke in den Garten. Der Flieder blüht, der Schneeball auch, und bald werde ich Holdersaft ansetzen. Es duftet in konzertierten Nuancen und die Tastatur ist voller Blütenstaub. Im Hühnerstall gibt es nun jeden Tag ein Ei zu ernten und das neue alte Hochbeet ist vorbereitet für die Anbausaison. In den letzten Wochen habe ich oft gedacht, dass wir gesegnet seien. Mit eigenen Walnüssen und Bärlauch vor der Haustüre, mit eingekochten Beeren und anderem Allerlei vom letzten Jahr lässt es sich sehr lange überleben. Diese (natürlich nicht allumfassende) Selbstversorgung ist mir seit Tschernobyl ein Anliegen gewesen. Damals war mein erster Sohn ein Jahr alt und ich habe die ersten Hamsterkäufe meines Lebens erlebt. Aber das weißt du ja, ich habe das an anderer Stelle schon beschrieben. Aber wusstest Du, dass es dort jetzt schon so lange brennt? Auch diesbezüglich überlagern sich Bilder in meinem Kopf. Wir haben in 34 Jahren nichts gelernt. Also schaue ich an diesem Sonntag in den Garten, höre die Vögel singen, sehe dem Spatz zu, der an einem Eck des Hochbeetes landet, die Kante entlang hüpft, was nicht unkompliziert ist für ihn, sehe, wie er auf die frische Erde kackt und davonfliegt. Eine kleine Selbstverständlichkeit wird zu einer Koordinate auf meiner Sicherheitskarte. Mao hat einst eine Hungerkatastrophe ausgelöst durch die Vernichtung der Vögel.
Zurück zu den Wegen. Die beruflichen Wege gehe ich seit vier Jahren auf drei Beinen.
Ein Bein heißt Altenbetreuung; an einer momentan wechselnden Zahl von Tagen in der Woche betreue ich eine alte Dame, die an Demenz leidet. Sie wird heuer neunzig. Die Tage mit ihr sind fallweise zeitlos. Wir machen alles, was wir machen, in einer Langsamkeit, die mich wohl allmählich zu prägen beginnt.
Ein Bein heißt nach wie vor Literatur. Es gibt zwei Projekte, die wohl noch länger nicht abgeschlossen sind, aber ich habe auch hier keine Eile. Auch die Pausen zwischen den Sätzen meiner alten Dame prägen allmählich meinen Umgang mit Sprache und deren Inhalt. Ich nehme diesbezüglich einen Kredit auf die Zukunft. Nicht alles muss jetzt veröffentlicht werden.
Das dritte Bein ist meine Arbeit im Atelier, das ich in Lustenau (der Nachbargemeinde von Hohenems) habe. Dort zeichne ich mit Tinte und Feder die Muster der Lebendigkeit des Lebens so wie ich sie verstehe. Es ist wohl ebenso ein Schweigen wie die intensivsten Momente mit meiner alten Dame ein Schweigen im Schweigen sind. Eine Form von Gebet. Eine stille Liebe.
Alle drei meiner Beine fußen auf einer Einsamkeit, die ich selbst gewählt habe. Doch zunehmend mit der Zeit im Shutdown ist mir, als hätte man mir eine verordnete Einsamkeit über die schon vorhandene selbstgewählte gestülpt. Die Wörter verhallten in dieser Isolierschicht dazwischen, die Zeichen, die meine Hand mit der Feder auf das Papier brachte, waren nicht mehr jene, die sie sein wollten. Ich habe nicht mehr geschrieben und habe aufgehört ins Atelier zu gehen, in welchem ich zuvor intensiv für eine Ausstellung im Herbst gearbeitet hatte. Doch jetzt gibt es da ein Du am anderen Ende der Welt, und ich freue mich, dass wir uns direkt schreiben und nicht nur unsere Texte, verfasst zu einem bestimmten Thema, in einem Band nebeneinandergestellt, lesen.
Dein Du ist mir übrigens auch wie die Auferstehung der Küchenuhr, die ich vor sechs Wochen abgehängt hatte. Ich habe die Zeit zwischen der Zeit verloren. Die Zeit ist an den Wechsel von Licht und Dunkelheit gebunden. Ich schlafe jetzt mehr als all die Jahre zuvor. Tagsüber wäre die Zeit an die vielen kleinen Wege meiner Finger gebunden. Im Nichtstun gibt es keine Orientierung. Das Denken kreist. Jetzt wird das Du zum heilenden Auftrag und ich danke dafür.
Dabei hatte alles anders angefangen. Das erste Bild, das ich mit dieser weltweiten Krise verbinde, ist wieder eines aus China. Eine leere Stadt. Die Menschen sitzen in ihren Wohnungen, die Stadt ist in Viertel eingeteilt. Eine App sagt dir, ob du die Wohnung verlassen darfst, in welches Viertel du gehen darfst und in welches nicht. Ein App sagt dir auch, ob dein Nachbar infiziert ist oder nicht. Überwachung von oben. Überwachung auf Augenhöhe. Überwachung von innen, weil du ständig Fieber misst. Das hat mir Angst gemacht, mehr als das Virus. Irgendwo habe ich gelesen, wenn man den Menschen Freiheit und Gesundheit zur Wahl stellte, würden sie sich für Gesundheit entscheiden. Damals war China noch weit weg. Wir schrieben den 11. März. Ich war schon zwei Wochen vorher in keiner Art von Öffentlichkeit mehr gewesen, um meine alte Dame nicht unwissentlich anzustecken.
Einen Tag später telefonierte ich mit meiner Tochter in Lissabon. Sie macht dort im Erasmusprogramm ein Auslandssemester. Sie sprach davon, dass man munkle, dass es bald einen Lockdown gäbe. (Ich musste das Wort erst nachschlagen. Zum ersten Mal im Leben bedauerte ich, keinen Fernseher zu besitzen.) Ich hörte sie am Telefon husten, sie hatte die letzten zwei Wochen eine Grippe gehabt. Zum ersten Mal machte ich mir Sorgen.
Am 16. März kam dieser Lockdown. Ich weiß noch, wie ich den Arbeitsvertrag und den Mietvertrag für das Atelier ins Handschuhfach des Autos legte. Als ich an diesem Abend, es war schon dunkel, von meiner alten Dame nach Hause fuhr, waren nur fünf Autos auf der Rheintalautobahn unterwegs. Alle fuhren hintereinander mit nur 100 kmh. Keiner überholte. Es war, als wollten wir uns alle nicht gerne aus der Sicht verlieren. Als ich von der Autobahn abfuhr und bei der ersten Ampel hielt, fragte ich mich, wieso ich das tat. Kein Mensch, kein anderes Auto war zu sehen. Das war höchst seltsam. Ich dachte daran, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen meine Arbeit noch hatte, dass ich mich noch bewegen durfte, dass ich fast keine Einbußen erlitt und dass wir einen Garten hatten, der mit vielen Aufgaben auf uns wartete. Ich fühlte mich krisensicher. Und doch war da dieses Gefühl der Surrealität. Ringsum verschwand eine ganze Welt und mir wurde über Nacht „Systemrelevanz“ beschienen. Von der Systemkritik zur Systemrelevanz innerhalb von Stunden. Das Wort Zusammenhalt war in aller Munde und wurde in diesem Land von vielen Menschen in die Tat umgesetzt. Ich war tief berührt davon, dass die Vorarlberger Industrie z.B. sich plötzlich zusammenschloss und Schutzmasken für das medizinische Personal zu produzieren begann. Ich war froh, dass diese Krise vielleicht einen höheren Sinn barg.
Dann korrespondierte ich mit meiner französischen Freundin. Sie schrieb mir, ihre Kinder, beide Ärzte, seien an der Front. Ich war schwer irritiert. Von Krieg war die Rede. Von Sieg war die Rede. Ich sah den offenen Grenzen zu, wie sie der Reihe nach umfielen. Ich weiß, das ist ein Bild, das nicht funktioniert, und doch war es in meiner Wahrnehmung so da – das mag an diesem Dominoeffekt liegen. Die Grenzen werden jetzt bewacht und da der Flugplatz unseres Landes gleich hier in der Nähe ist, hörte ich mitten in dieser gespenstischen Stille den Hubschrauber ständig starten und landen, alle anderen Flugobjekte waren vom Himmel verschwunden. Ich hörte unseren Innenminister uns zu Lebensrettern erklären, und dachte, dass das Wort sein Gegenteil enthalte. Es dauerte auch nicht lange und jene, die keinen der fünf guten Gründe hatten, das Haus zu verlassen, und draußen angetroffen wurden, zahlten saftige Strafen und wurden zu Lebensgefährdern erklärt, weil sie ja stille Symptomträger sein könnten. Tagtäglich wurden und werden im Fernsehen die Zahlen der Gefallenen in diesem Krieg veröffentlicht. Eine ganze Nation, ganze Nationen weltweit verfolgen an Bildschirmen jeden einzelnen Tod in Form einer Addition. Die Waffen in diesem Krieg sind Drohungen. Wenn wir uns nicht eingrenzen, sagt der Kanzler, haben wir mit hunderttausend Toten zu rechnen, dann wird bald jeder jemanden kennen, der einen Menschen verloren hat. Das sagt er mit einem Gesicht, das keinerlei Besorgung erkennen lässt. Und zusätzlich hält er sich selbst an den Händen, eine Mischung aus Faltung und Reibung. Botschaft und Gestik sind nicht kohärent. Das war am 30. März. Ab da schlichen sich seltsame Gedanken bei mir ein. Wenn wir uns nicht eingrenzen. Das heißt, wir werden alle zu Soldaten in diesem Krieg gemacht, zu feindlichen Soldaten sozusagen, da, wenn wir nicht unterlassen, der Krieg verloren geht. Gesunde Menschen werden zur Bedrohung verkehrt.
Zuvor war ich ein gesunder Mensch gewesen. Dass ich durch meine Tätigkeit in der Altenbetreuung plötzlich zum systemrelevanten Menschen und gleichzeitig zur möglichen Lebensgefährderin erklärt wurde, ließ meinen Blutdruck in die Höhe fahren. Und das wiederum erschien mir so kurios, da ich mich doch vorher schon freiwillig an diese ganzen Beschränkungen gehalten hatte, um meine alte Dame nicht zu gefährden. Es muss an dieser Kriegsrhetorik liegen, dachte ich. Und als am 4. April die Bilder aus China zum Gedenken an die Coronatoten um die Welt gingen, da ging mein Blutdruck endgültig durch die Decke. Wie bringt man jeden einzelnen Menschen eines Staates dazu, zeitgleich für drei Minuten stillzustehen, egal ob er im Auto sitzt, in der U-Bahn unterwegs ist oder auf dem Feld arbeitet? Ich habe vor diesem Überwachungsstaat offensichtlich viel mehr Angst als persönlich vor dem Virus. Ich litt noch nie in meinem Leben an Bluthochdruck, deshalb suchte ich einen Arzt auf. Er verschrieb mir ein blutdrucksenkendes Mittel. Und so mutierte ich zu einem systemrelevanten Risikogruppenmitglied, das gleichzeitig eine potentielle Lebensgefährderin ist, da ich zu meinem Mann nicht auf absolute Distanz gehen kann, der ebenfalls ein systemrelevanter potentieller Lebensgefährder ist, da er nach wie vor in seiner Firma mit vielen, wenn auch jetzt mit weniger Menschen, arbeitet. Wir atmen dieselbe Luft, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wir haben uns seit Wochen nicht mehr geküsst. Ich ermahne ihn des Händewaschens und hasse mich dafür.
Meine alte Dame leidet auch. Wir haben, schon bevor die Altersheime das hier taten, Besuche untersagt und statt der täglichen Spaziergänge in die Stadt, um Kaffee zu trinken und allfällige noch verbliebene Bekannte zu treffen, einsame Gänge durch ein menschenleeres Viertel getätigt – sie mit dem Rollator, ich mit Maske. Am letzten Freitag blieben wir vor einem Zebrastreifen stehen, weil ich aus der Ferne zwei Radfahrerinnen entgegenkommen sah. Die erste Radfahrerin ist vorbei gesaust, die zweite bremste ab und blieb stehen. Ich sah ihr ins Gesicht und bedankte mich. Sie senkte ihren Kopf und sagte: „Ich danke Ihnen.“ Ich war verwundert, wieso dankte sie mir? Wieso senkte sie den Kopf? Erst viele Schritte später begann ich zu verstehen. Sie dankte mir dafür, dass ich meine Arbeit fortsetzte. Viele Betreuerinnen sind noch kurz vor dem Shutdown in ihre Heimat gereist. Nach Rumänien, in die Slowakei. Nicht alle konnten zurückkommen. Für jene, die blieben, wird es einen Bonus von 500 Euro geben. Man dankt hier den Menschen, die blieben, um das System aufrechtzuerhalten, aber der Betrag ist lächerlich, er ist wohl am Lohn für zwei Wochen gemessen. Dieses Virus deckt viele Missstände auf, auch und gerade im Betreuungssystem.
Ich habe gemerkt, dass diese Arbeit mich zunehmend belastet. Nicht die Arbeit selbst, aber dass ich jetzt Nasenmundschutz und Handschuhe tragen soll. Berührung ist für alle Menschen wichtig, speziell für demente Menschen. Vor vier Jahren habe ich diese Berührungen eingeführt, sie haben meiner alten Dame über viele Stunden der Angst, die sie immer dann entwickelte, wenn ein Bewusstseinsfenster sich öffnete, und ihr klar wurde, was sie alles verliert, hinweggeholfen. Diese Berührungen – und mich kennt sie nicht am Namen oder am Gesicht – mich erkennt sie an meinen Berührungen. An der Sprache und am Inhalt der Gespräche. Ahja, Sie sind das, sagt sie dann. Diese Berührungen soll ich mit Handschuhen machen? Das geht nicht. Sie würde in noch mehr Isolation verfallen. Darum halte ich Abstand zu meinem Mann. Was, wenn ich die Überbringerin des Virus wäre? Hier in Österreich und auch in Frankreich hört man, die ersten Untersuchungen und Vorbereitungen von Klagen in Bezug auf Altersheime und das Versagen der Leitung seien schon im Gange. Laut WHO seien 50% der Todesfälle nach einer Infektion mit Corona in Europa in Pflegeeinrichtungen vorgekommen. Es ist so schwer, die Menschen in Heimen zu schützen. Irgendwo habe ich gelesen, in Schweden hätten die Putzfrauen, die auch in Hotels arbeiten, das Virus in die Heime gebracht. An diese Möglichkeit hatte ich gar nie gedacht. Diese armen, armen Putzfrauen. Und es bleibt völlig ungesagt und unbescholten, dass die einzelnen Regierungen im Jänner die Hilfe der EU ausschlugen -wochenlang gab es nirgendwo genügend Schutzausrüstung (schon wieder so ein Kriegsbegriff).
Ich weiß noch nicht, wie ich weiter mit dieser Situation umgehen werde. Als ich im Jänner eine schwere Grippe hatte, bin ich meiner alten Dame ferngeblieben, bis ich mich wieder gesund fühlte. Da handelte es sich um zwei Wochen. Jetzt ist die Situation eine andere. Immer öfter taucht der Gedanke auf, meine Arbeit in der Betreuung aufzugeben, weil ich den Wunsch hege, meine Kinder wiederzusehen, sie zu umarmen und mein Enkelkind zu knuddeln. Der Kleine ist ein Jahr alt und braungebrannt, wie ich auf Fotos sehe. Ich betrachte ihn, die pure Lebendigkeit, während Tränen auf die Tastatur fallen. Vermischt mit dem Blütenstaub ergeben sie ein seltsames Muster.
Hunderttausend Tote. Diese Annahme vom 30. März. Der Stress, den das in mir auslöste. Und eine gefühlte Woche später kündigt der Kanzler das Hochfahren des Tourismus für Mitte Mai an. Dieses technische Wort Hochfahren, als wären Menschen Maschinen. Dieselbe Mimik und Gestik wie bei der Ankündigung der hunderttausend Toten. Ich hatte mich auch für gezielte Öffnungen ausgesprochen, weil die produzierte Arbeitslosigkeit gigantisch ist. Ich hatte allerdings an die kleinen Geschäfte gedacht, an kleine Lokale, an kleine kulturelle Veranstaltungen und kleinere Betriebe, wo Kontakte überschaubar bleiben. Aber der Tourismus? Wo doch die allergrößte Zusammenrottung des Feindes (des Virus) in Ischgl geschah, von wo das Virus in die ganze Welt transportiert wurde? Ich war entsetzt. So viel nationale Anstrengung und Entbehrung, um den Tourismus wieder anzukurbeln? Wo hier und jetzt immer noch Polizei in den Bergen kontrolliert, ob man den Abstand wahrt, was mir das Wandern vermiest? Wie passt das alles zusammen? In meiner Naivität nahm ich an, dass der Kanzler und sein Beraterstab sich wohl verrechnet hatten. Ich dachte, wir hätten längst eine Herdenimmunität erreicht, die Herdenimmunität gegen Kritik. Bürgerrechte fallen reihenweise, zwar mit Ablaufdatum der Einschränkung versehen, aber aufgrund der Sprache der Kommunikation ist mir deutlich unwohl. Der Kanzler hat sich nie zur Ausschaltung des Parlaments in Ungarn geäußert. Was, wenn ihm das gefiele? Was, wenn er, jetzt auf dem Höhepunkt der Umfragewerte, eine dritte Regierung sprengte? Ich traue ihm und seiner Partei nicht zu, die richtigen Konsequenzen aus dieser Krise zu ziehen. Die anstehenden, vielfachen Dürren werden es zeigen.
Auf einer anderen Ebene habe ich das Gefühl, das alles schon einmal erlebt zu haben. Eine Geschichte. Versteckt in all diesen Büchern im Regal. Ich stehe davor und mir fällt der Name des Autors nicht ein. Es ist ein Mann, ich tippe auf Raymond Carver. Das Cover, das ich vage im Kopf hatte, passt aber nicht. Es ist jedenfalls ein Amerikaner. Ich habe die Bücher, so gut es geht, nach Ländern geordnet. Aus unerfindlichen Gründen ist T.C. Boyle woanders hingeraten. „Moderne Liebe“ heißt die Geschichte, Du kennst sie sicher, was erzähle ich Dir da. Diese Lust an abartigen Krankheiten, die gleichzeitige Angst davor, das Ganzkörperkondom, in welchem die beiden jungen Liebenden miteinander schlafen. Die umfassende Arztuntersuchung bis hin zur Genetik, die der junge Mann über sich ergehen lassen muss, damit sie mit ihm zusammenbleibt. Nach der Untersuchung hört er nichts mehr von ihr. Er erfährt weder von ihr noch vom Arzt, an welchem nicht sichtbaren Makel er leidet. Er ruft sie an. Sie ist ablehnend. Er sagt: „Aber wir waren uns doch so nahe!“ Sie sagt: „So nahe dann auch wieder nicht…“.
Abstand. Keine Berührungen. Das „New Normal“ aus Boyles Geschichte wird jetzt im Silikon Valley verkündet, daran wird dort von den Start-Ups mit Lichtgeschwindigkeit gearbeitet. Wir werden nach Corona in einer Gesellschaft leben, die ohne Berührung auskommen will, so tönt es. Touchless am Flughafen, beim Shopping usw., weil die mögliche Bedrohung durch Pandemien und Grippewellen bleibt. Touchless in Altersheimen, da wir die Menschen dort jetzt nicht schützen konnten? Eine solche Welt verliert für mich an Wirklichkeit.
Eines der wichtigsten Muster der Lebendigkeit des Lebens ist der Spalt. Im synaptischen Spalt wird ein elektrisches Signal in ein chemisches umgewandelt. So findet Austausch statt. Und so mag ich mit dir hoffen, dass wir als Art chemische Radikale uns in neuem Denken verbinden. Eines der wichtigsten Lebensprinzipien ist jenes der Osmose. Vielleicht, so mag ich denken, ist die Erscheinung der weltumspannenden Unsicherheit eine Art semipermeable Wand, an der sich ein Konzentrationsausgleich zum Überleben der Zellen abspielt. Vielleicht gelingt es den vielen kleinen Initiativen der momentan gelebten Solidarität sich in den Köpfen der Menschen mehr festzustecken als der Glaube an die Überlegenheit des Wettbewerbs, der so viel Armut produziert.
Es ist Abend geworden, die Lufttemperatur ist schlagartig gesunken, und ich muss den Sonnenschirm einholen. Gleich wird es regnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute Abend eine Fledermaus gesehen habe. Ihr Flattern ist zur Zeit die letzte Bewegung in der Natur, die ich wahrnehme, bevor ich mich ins Haus zurückziehe. In den letzten Jahren ist es ein paar Mal geschehen, dass sich eine Fledermaus ins Obergeschoss verirrt hat. Da hilft nur, die Lichter alle auszuschalten und alle Fenster zu öffnen – und Geduld.
So schicke ich Dir herzliche Grüße über den Teich in ein Land, in dem ich noch nie war.
Alles Liebe,
Gabriele
24. April 2020
Liebe Gabriele,
Wir haben uns noch nie getroffen. Doch würde ich nicht sagen, dass wir uns nicht kennen. Oder zumindest: dass ich Dich nicht kenne. Dazu habe ich beim Lesen Deiner Texte schon zuviel über Dich erfahren. Zunächst allerdings dies: Ich hoffe, dass Dir die vertraute Anrede nicht unangebracht scheint. Die Entscheidung, ohne lange Umstände oder Anfragen in diesem ersten Brief die Du-Form zu verwenden, habe ich nach längerem Zögern getroffen. Insgeheim hatte ich gehofft, dass Du vielleicht in unserem Briefwechsel den Anfang machen und damit die Tonlage und vielleicht auch schon das eine oder andere Thema vorgeben würdest. Was die passende Anrede betrifft, fällt es mir nicht leicht zu beurteilen, ob meine Befindlichkeiten in dieser Frage auf der Höhe der Zeit sind. Dafür lebe ich schon zu lange in einem Sprachraum, in dem es die Unterscheidung zwischen informeller Anrede und Höflichkeitsform längst nicht mehr gibt. Ausserdem gehöre ich zu jener Generation, die erwachsen wurde, als sich Anredeformen und manche Anstandsregeln, die uns im Kindesalter eingebläut wurden, zu verflüchtigen begannen. Später lebte ich als Student einige Jahre in Zürich. Ich glaubte, mich mit einem höflichen “Sie” im Zweifelsfall durchschlagen zu können, bis ich an eine Kellnerin geriet, die beleidigt bemerkte, sie sei für diese Anrede nicht alt genug, und was ich damit eigentlich beweisen wolle? Darauf wusste ich keine Antwort. Von diesem Zeitpunkt an schien jede neue Begegnung komplizierte Abwägungen zu verlangen, um die Beteiligten nicht vor den Kopf zu stossen und der Situation gerecht zu werden.
Als ich nach Amerika kam, gefiel es mir, dass hier jeder unterschiedslos mit “you” angesprochen wird. Dabei war das “you” des Immigrationsbeamten autoritärer, als noch das zackigste “Sie” je hätte sein können. Trotzdem glaubte ich, in der nur durch den Tonfall modulierten, als Wort aber gleich bleibenden Anrede die ursprüngliche politische Vision dieses Landes erkennen zu können, eine Art Versprechen, das in jedem Gespräch erneuert wird. Daran gewöhnte ich mich gern. Im Gegensatz zu Zürich, einer Stadt, die mir vor allem den Rücken zugewandt hatte, war es in Chicago, der weitaus grösseren und, wie man vermuten würde, anonymeren Metropole, leicht, mit Leuten, die man nicht kannte, ins Gespräch zu kommen und dann – das fiel mir anfangs nicht leicht – auch wieder weiterzugehen, ohne nach dem Namen des anderen gefragt oder den eigenen genannt zu haben. Die englische Sprache nötigte mich nicht, im Voraus zu entscheiden, in welcher Nähe oder Ferne ich mich gegenüber einer anderen Person verortete, und zu bestimmen, welche Verbindlichkeiten ich eingehen wollte und wie formell oder informell ich die Situation einschätzte, in der ich mich gerade befand. Die ersten Monate im neuen Land waren allein deshalb nicht nur eine Einübung in ein anderes Sprechen, sondern vor allem auch in einen andere Art von Gesellschaft.
Am dritten oder vierten Tag im neuen Land ging ich von der Universität zum Bahnhof, um mit dem Pendlerzug nach Hause zu fahren. Ich wohnte die ersten zwei Wochen bei einer Gastfamilie etwas ausserhalb der Stadt. Der Vater wollte mich dort am Bahnhof abholen und hatte mich gebeten, vorher anzurufen. Als ich vor der langen Reihe von Telefonautomaten stand – es gab noch keine Handys –, bemerkte ich, dass ich nur eine 5-Dollar-Note in der Tasche hatte. Es war nach Feierabend, und der ganze Bahnhof war voll von Menschen. Ich ging auf einen Mann in einem eleganten, blauen Anzug zu, der ein ledernes Aktenköfferchen trug. Er schaute auf, als ich ihn fragte, ob er meine fünf Dollar vielleicht wechseln könne, da ich Münzen brauche, um zu telefonieren. Er steckte seine Hand in die Hosentasche, gab mir eine Handvoll Kleingeld und sagte: “Don’t worry!” Im Weitergehen rief er noch: “Good luck, son!”, bevor er in der Menschenmenge verschwand.
Erst Jahre später begann ich mich zu fragen, ob mir dieser Mann auch geholfen hätte, wenn meine Haut dunkler wäre, und ich einen anderen, nicht-europäischen Akzent hätte. Seine Geste war herzlich und spontan gewesen. Etwas in mir sträubt sich dagegen, diese Grosszügigkeit in Zweifel zu ziehen. Ich rede mir ein, dass solche Äusserlichkeiten für ihn keine Rolle gespielt hätten. Zugleich weiss ich, dass die Statistiken gegen mich sprechen. Schon nach wenigen Wochen in Chicago wurde mir bewusst, dass es mit Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit nicht weit her war in diesem Land der grossen Träume. Die Träume aber – sie blieben mir lieb.
In der von einem Virus ausgelösten gegenwärtigen Krise werden diese Träume mehr denn je auf die Probe gestellt. Sozialen Unterschiede, über die das joviale “you” hinwegzutäuschen vermag, treten umso deutlicher hervor. Wer sind die Leute, die noch immer den Abfall abholen, die Pakete ausliefern, den Rasen in den Vorgärten mähen? In den Städten, liest man, steigt die Flut der Toten in armen und schwarzen Nachbarschaften wie nirgendwo sonst. Manche Kommentatoren, die zum schmeichelnden Hofstaat eines unfähigen Präsidenten mit Allmachtsfantasien gehören und das Offensichtliche nicht wahrhaben wollen, behaupten ohne den geringsten Beweis, die Betroffenen hätten es sich selbst zuzuschreiben, da sie sich nicht an die verordneten Massnahmen hielten. Die Wahrheit sieht etwas anders aus: Lange sträubte sich dieselbe Regierung – zuvorderst jener Präsident, der sich um nichts als seine Wahlchancen und den Gewinn seiner Firmen schert – die Kosten für die erforderlichen medizinischen Tests zu übernehmen. Noch dazu deckte seine Regierung die Krankenkassen, die gleichfalls von diesen Kosten nichts wissen wollen. Den Armen, von denen der Grossteil sich ohnehin keine Krankenversicherung leisten kann, und denjenigen Menschen, die seit Jahren langsam aus dem Mittelstand in die Unterschicht abrutschen und deren Gesundheitsversorgung davon abhängt, was von ihrer Versicherung bewilligt wird, bleibt nichts anderes übrig, als sich mehr schlecht als recht zu schützen, wenn sie ihre Jobs für den Minimalstundenlohn von $ 7.25 erledigen. Keiner weiss, wer das Virus in sich trägt und gerade dabei ist, alle seine Arbeitskollegen anzustecken.
Hier in Ithaca, auf halbem Weg zwischen New York City und Buffalo, zwischen Hügeln und Wäldern, Wasserfällen und Seen leben wir seit Wochen in einem seltsamen Schwebezustand. Die Cornell University, an der ich arbeite und die der grösste Arbeitgeber in dieser Kleinstadt ist, stellte im März, noch bevor die Regierung in Washington sich zu entsprechenden Empfehlungen durchringen konnte, den ganzen Lehr- und Forschungsbetrieb drei Wochen lang ein, um alle Lehrveranstaltungen auf ein Internetformat umzustellen. Das war für Professoren und Forscher eine Herausforderung, denn nicht jedes Seminar und jedes Labor kann ohne weiteres auf die unmittelbare Realität, die Anwesenheit der Studierenden und die Materialität der zu untersuchenden Gegenstände verzichten. Als Kulturwissenschaftler fiel mir das leichter als einer guten österreichischen Freundin, die hier als Astronomin arbeitet.
Die Läden und vielen Restaurants der Stadt blieben zunächst noch geöffnet. An einem der letzten Abende, an denen das gesellschaftliche Leben noch nicht zum Stillstand gekommen war, gingen meine Frau und ich mit unserem vierjährigen Sohn und unserem Hund in unser Lieblingsrestaurant essen. Es war gut gefüllt. Die Leute hielten ein wenig linkisch Abstand voneinander, denn man musste sich an diese neue Realität erst noch gewöhnen. Viele hatten Handseife dabei. Andere rannten alle paar Minuten auf die Toilette, um dort ihre Hände zu waschen. Es war ein heller, sonniger Abend, der schon den nahenden Frühling ankündigte. Man nahm alles gelassen und war sich noch nicht bewusst, was schon zwei Tage später auf uns zukommen würde.
Es ist schwierig zu den aktuellen Entwicklungen in Amerika etwas zu schreiben, das nicht schon am nächsten Tag von einer neuen, von höchster Stelle abgesegneten oder sogar initiierten Absurdität überholt wird. Lange hatte der Präsident die Krise bestritten und bagatellisiert, bis er schliesslich Mitte März einsehen musste, dass noch das vehementeste Leugnen, unterstützt von einem weit gespannten Propagandaapparat mit dem Fernsehsender Fox News und unzähligen Talk-Radio-Stationen sowie allen erdenklichen konspirativen Webseiten und anderen Internetformaten, am Ende die rasant ansteigende Anzahl von Infektionen und Todesfällen nicht ungeschehen machen kann. Der Präsident hält sich selbst für ein medizinisches Naturtalent, was er auf seine ausgezeichneten Erbanlagen und einen Onkel zurückführt, der am berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) Professor für Ingenieurwissenschaft war und dessen Erfindungen für die Anwendung von Röntgenstrahlen und die Strahlentherapie wichtig waren. Der Präsident, der aufgrund dieser natürlichen Qualifikationen von sich behauptet, komplexe medizinische Probleme auf Anhieb intuitiv zu verstehen, versuchte darauf, sich als entschlossener Krisenmanager in Szene zu setzen. Auch hier sollte die unaufhörliche Wiederholung der immer gleichen Lügen – nämlich dass er als erster die Gefahr erkannt und sofort gehandelt habe – eine neue, alternative Wahrheit schaffen. Journalisten, die bei Pressekonferenzen des Weissen Hauses kritisch nachfragen, werden vom Präsidenten persönlich beschimpft und als moralisch fragwürdige Personen verunglimpft. In manchen Fällen wird ihnen kurzerhand die Akkreditierung entzogen – ein unerhörter Vorgang in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ich habe den Eindruck, dass man sich in Europa nicht im Klaren darüber ist, in welchem Masse die gegenwärtige Regierung demokratische Grundrechte und Institutionen in den letzten Jahren ausgehöhlt hat. Im Windschatten des Virus hat sich diese Tendenz noch gesteigert. Sie ist in mancher Hinsicht beängstigender als die eigentliche Pandemie.
In den Tagesnachrichten sieht man jetzt viele Menschen, die, angestachelt vom Präsidenten, gegen die von seiner eigenen Regierung angeordneten Massnahmen protestieren. Viele meiner akademischen Freunde sehen in ihnen nur rechts-konservative Fanatiker. Die gibt es, keine Frage. Allerdings sind bei diesen Demonstrationen auch viele dabei, die ihre Arbeitsstelle verloren haben, sei es auf Zeit oder permanent. Seit Beginn der Coronakrise sind bereits gut 22 Millionen Amerikaner arbeitslos geworden. Die “soup kitchens,” in denen Bedürftige etwas zu essen bekommen, melden Engpässe und diskutieren über die Möglichkeit, das Essen zu rationieren. Es ist absehbar, dass bald mehr Menschen ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können und Konkurs anmelden müssen als nach der Finanzkrise von 2008. Diese Menschen, die sich seit Jahrzehnten von der Regierung allein gelassen fühlen, haben keine Zeit, um lange auf einen noch fernen Aufschwung zu warten. Viele von ihnen wollen an ihren oft schlecht bezahlten Jobs festhalten, bei denen soziale Distanzierung kaum möglich ist. Vor die Wahl zwischen finanziellem Ruin und diffuser Corona-Gefahr gestellt, zögern sie nicht lange. Denn von höchster Stelle in Washington werden die Auswirkungen des Virus noch immer zum Nutzen der Wirtschaft heruntergespielt.
Unter den Transparenten und Plakaten der Demonstranten entdeckte ich eines, auf dem stand “Give me liberty or give me death!” Freiheit oder Leben. Das war die von Patrick Henry – er war einer der sogenannten founding fathers der amerikanischen Nation – ausgegebene Devise im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Man kann nicht sagen, dass diese Demonstranten, die einem sich despotisch gerierenden Präsidenten zujubeln, verstanden haben, worum es Patrick Henry gegangen war.
Ich sitze hier in Ithaca, arbeite weiter, so gut es mit einem vierjährigen Kind zuhause geht. Doch kann ich mich der schleichenden Melancholie nicht entziehen. Ich frage mich, was für eine Welt mit Covid-19 begonnen hat. Die Krise kam mit Ankündigung. SARS und MERS hatten wir schon, weitere Mutationen und Virusübertragungen über Artengrenzen hinweg sind vorhersehbar. Es wäre vermessen zu behaupten, dass unsere westliche Gesellschaftsordnung darauf eingestellt sei. Und zugleich wird im Moment deutlicher als vielleicht je zuvor, dass das demokratische Experiment Amerika am Abgrund steht. Der Gedanke macht mich schaudern.
Eine auffällige Sache – vielleicht ein Hoffnungsschimmer – an der gegenwärtigen Krise: Sie ist nicht lokal, nicht begrenzt und auf absehbare Zeit auch nicht eingrenzbar. Was mich daran interessiert ist weniger die damit verbundene Gefahr, sondern die Tatsache, dass die Situation und die getroffenen Massnahmen an allen Ecken und Enden der Welt recht ähnlich sind. Die Posts von Bekannten in Neuseeland, die Berichte meiner Verwandten in Liechtenstein, meiner Freunde in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Japan und Brasilien gleichen sich. Es ist, als hätte die mehr oder weniger resolut vorangetriebene, letztlich unvermeidliche Vereinzelung jede und jeden aus ihren bisher stillschweigend vorausgesetzten sozialen Konstellationen herausgelöst und dabei zu einer Art chemischem Radikal gemacht, das sich rundherum als sehr bindungsfreudig erweist, wenn auch nur in virtuellen Medien, die das alles auf Distanz halten.
Wenn ich an meinem Schreibtisch lese, nachdenke und schreibe, schaue ich dazwischen oft hinaus in den Garten, wo die leuchtenden Frühlingsblumen schon langsam verblühen. Am Abend beobachte ich das Murmeltier, das nach ein paar Tagen Abwesenheit, während derer ich schon befürchtete, dass es von einem Nachbarn vertrieben oder in der Nacht von einem Kojoten geholt worden sei, zurückgekommen ist. Es lässt sich Zeit, schnuppert im Gras herum, um die saftigsten Blätter und Kräuter zu finden. Ab und zu setzt es sich auf die Hinterbeine und horcht. Wenn es etwas Ungewohntes hört, macht es sich schnell aus dem Staub. Später kommt es wieder, frisst weiter und trollt sich, wenn es genug hat. Ich schaue ihm gern zu. Ein Quantum Trost würde in meinem jetzigen Leben fehlen, wenn es nicht mehr käme.
Mit herzlichen Grüssen aus Ithaca, N.Y.,
Peter
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von Literaturhaus Liechtenstein, Literaturhaus & Bibliothek Wyborada, dem SAAV und literatur.ist.