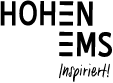Cara Roberta. Verena Roßbacher & Yannic Han Biao Federer

20. Mai 2020
Verena,
die Mauer im Hang ist jetzt nicht mehr alleine, eine zweite hat sich hinzugesellt, offenbar sollen sie gemeinsam das Gewicht der Anhöhe tragen. Davor noch immer der gelbe Hydraulikbagger, er schichtet groben Kies zwischen Erdreich und Beton, abseits Aufschüttungen verschiedenfarbiger Erde, die wohl obenauf liegen wird, mit dem Rüttelstampfer zu einem festen Fundament gefügt. Ein Vorarbeiter gibt Anweisungen, wenn er die Handfläche neigt, kippt die Baggerschaufel seitwärts, gießt ihren Inhalt in die Senke, hält er sie gerade, versiegt ihr Strom. Manchmal winkt er dem Kollegen im Cockpit, bevor er von der Leiter springt, einen Spaten schultert und hinter dem Betonvorsprung verschwindet, um dort irgendetwas zurechtzuscharren. Es dauert, so lange, dass ich ungeduldig werde, weil ich zurück an den Schreibtisch muss, schließlich tatsächlich hinübergehe und nur noch hoffen kann, dass er dort nicht versehentlich begraben wird.
Entschuldige, schon wieder die Baustelle, ich fand es nur so schön, wie dort die Dinge und Menschen zusammenwirken, ineinandergreifen, helfend und vertrauend aufeinander. Und eigentlich eint auch uns beide mehr, als du glaubst. Zumindest als Einheit einer Differenz, würde Luhmann sagen, oder, in unserem Fall, als Einheit zweier Differenzen. Laut und leise. Schnell und langsam. Das Schnelle und Laute bringt es aber mit sich, dass manches nur verwischt auf den Bildträger findet, dass manches verzerrt auf der Tonspur. Es freut mich also, dass du das Stichwort der Genauigkeit aufwirfst, es ist mein Thema.
Dass es dir dort, wo ich von Politischer Theorie spreche, zu ungenau und abstrakt wird, beruht auf einem alten Missverständnis, das sich insbesondere an Theorie gut zeigen lässt. Abstraktion ist nämlich keineswegs etwas, das man erreicht, indem man alles Konkrete aus einem Bild entfernte, nein, es ist vielmehr etwas, das einer bewussten Setzung gleichkommt und sich in ihrer potentiellen Anwendbarkeit erst noch zu bewähren hat. Der veränderte Blick, den Theorie bietet, etwa der paranoide Blick der foucaultschen Machttheorie, entspricht ganz der Desautomatisierung von Wahrnehmung und Sprache, den die Formalisten als Wesenskern der Poetizität beschrieben haben, und es macht sie zur literarischsten Form aller wissenschaftlichen Literatur. Theorie ist also, wie Literatur, nicht die irgendwie abstrahierende Reformulierung ihrer Umwelt. Sie ist ein anderer und neuer Zugang zu ihr.
Um diesen aber zu erkennen, muss man schon genau lesen, muss man schon mitbekommen, dass ich autoritären Systemen an keiner Stelle eine wie auch immer geartete Affinität zu diskursiver Auseinandersetzung attestiert habe. Vielmehr ging es um die tiefgreifende Unterscheidung zwischen Systemen, in denen es ein heterarchisches Treiben zwischen eigenlogisch operierenden Subsystemen gibt, und solchen, in denen ein hierarchisch übergeordnetes Zentrum seine Kommunikationsweise jederzeit und nach Belieben den übrigen aufoktroyieren kann. Weniger luhmannianisch gesprochen: Wir haben das Glück, dass wir nicht über Politik sprechen müssen, wenn wir es nicht wollen. Andere haben das nicht. Es ging mir also gerade um einen pluralistischen Diskurs, den du dir doch auf die Fahnen geschrieben zu haben glaubst, nur dass du dich, in der angestrengten Negation eines vermeintlich übermächtigen Mainstreams, durch gerade diesen bestimmen lässt.
Wenn man ihn also erfassen wollte, diesen anderen und neuen Zugang, so müsste man auch die Radikalität erkennen, die in einer knappen Wendung verborgen liegen mag. Dass ich auf Arendts Postulat von der physischen Kopräsenz verwies, konntest du nicht nachvollziehen, du schriebst, du wüsstest gar nicht, wer denn um alles in der Welt diesen direkten physischen Kontakt nicht für wichtig hielte. Ich kann‘s dir sagen: ungefähr fast alle. Denn was Arendt im Kern fordert, ist ein räterepublikanisches Gemeinwesen, eine gestaffelte Anordnung öffentlicher Erscheinungsräume, die nur möglich werden, indem Menschen sich unmittelbar begegnen und diskutieren. Medialisierte Vermittlungsinstanzen und anonyme Wahlverfahren schließt sie aus, von Parteien will sie nichts wissen. Einzig die Diskussion zwischen physisch Anwesenden gewährleistet für sie das, was sie als die Freiheit des Politischen begreift. Die Phantasien von ‚direkter Demokratie‘, wie sie inzwischen auch von rechten Populisten aufgegriffen werden, sie wären ihr ein Graus. Zu groß die Gefahr, dass andere Mechanismen in Gang kommen, insbesondere diejenigen, die sie massentheoretisch (und durchaus problematisch) zu beschreiben versuchte. Aber auch hier gilt: Es bedarf der Distanz und der Zeit, um sich dies klarzumachen. Das Gaus-Interview auf YouTube zu gucken, es wäre Arendt wiederum nichts als ein unzureichendes Surrogat.
Ich verhandle all das am Beispiel der Theorie, weil ich hoffe, dadurch vielleicht den ein oder anderen Reflex zu mildern, etwa wenn sofort um Befindlichkeiten gekreist wird, nur weil irgendwo irgendwer nicht monothematisch und tagesaktuell im Chor mitbellen möchte. An der Theorie wird deutlich, was auch die Literatur betrifft: Sie kann nur sein, was sie ist, wenn sie nicht ist, was die anderen schon sind. Wer das als empfindsamen Rückzug in den Elfenbeinturm abtut, hat ein sehr begrenztes Verständnis von dem, was politisch ist, was Gesellschaft ist und was Relevanz bedeutet.
Eigentlich doch ein schönes Thema für ein Gespräch mit offenem Ausgang, für ein gemeinsames Nachdenken darüber, was das sein könnte, politisch zu schreiben, gerade weil wir so unterschiedlicher Meinung zu sein scheinen. Und ohne künstliches Streithammelgeblöke könnte man auch einmal riskieren, nicht unbedingt recht haben zu müssen. Das hat das Miteinandersprechen ja gemeinhin dem Streit voraus. Aber offenbar hast du schon die Segel gestrichen, was mich doch wundert, erst unbedingt Streit haben wollen, ja, unbedingt, du sagtest, er müsse sein, nicht, er könne. Und dann aus dem Raum stürmen, weil es doch irgendwie anstrengend wird.
Na ja. Wie dem auch sei. Hab es gut, Verena. Byebye.
15. Mai 2020
Lieber Yannic,
ich versuche, aus den wenigen Zeilen, die wir bisher gewechselt habe, eine Art Fazit zu ziehen, um eine Verortung zu ermöglichen. Also, fassen wir zusammen:
Streit: nein; Bagger: nein; Diskussion: nein; Spielplatz: nein, usw., es schaut, kurzum, schlecht aus, was die gemeinsame Themenfindung angeht. Es wundert mich ja selber, aber es läuft über kurz oder lang auf ein Beziehungsgespräch hinaus (ja, nervig).
In deinem Brief beschäftigst du dich unter anderem mit dem Nicht-streiten-müssen – eh klar, streiten müssen tut man nicht, und auch du und ich, wir müssen mitnichten miteinander streiten. Mir wird es zu ungenau und abstrakt, wenn du von totalitären Regimen sprichst und von Sprechweisen und Sprachregelungen des Politischen – ich finde es ungenau und abstrakt und vor allem falsch: Demokratie lebt von Auseinandersetzung – Streit ist nur eine der vielen, munteren Varianten davon – und gerade in autokratischen Systemen ist der Streit verpönt, er schwächt die Macht.
Aber kommen wir zu uns zurück, von wegen Beziehungsgespräch, denn ich denke, wir müssen das klären, um eine Entscheidung zu treffen, um die herumzulavieren nur Kraft und Zeit kostet.
Es heißt ja gern über Paare, sie seien glücklicher, wenn gestritten würde – allerdings nur, wenn über Dinge gestritten wird, für die es Lösungen gibt, also nichts Grundsätzliches. Lösungen gibt es beispielsweise für Fragen, die sich ums Geld drehen oder um Ordnung, Grundsätzliches wären Schwierigkeiten mit dem Charakter oder der Gesinnung. Ich würde jetzt mal sagen, wir beide sind ein Schreib-Paar, das sich nicht unbedingt an herumliegenden Socken aufreiben würde (metaphorisch, wir verstehen uns, es sind metaphorische Socken), sondern immer am Grundsätzlichen.
Du schreibst Dinge, über die ich generell anders denke – und, ja, ich will sie so nicht stehen lassen, also fühle ich mich genötigt, mit dir ein bisschen darüber zu streiten. Ein bisschen streiten kann man vielleicht ersetzen mit diskutieren. Sicher, du könntest sagen, dir gefällt meine Streitkultur nicht – wir könnten uns ja auf eine andere einigen. Du kannst auch sagen, du willst, Streitkultur hin oder her, weder streiten noch diskutieren, das ist dein gutes Recht. Es wird dann nur ein bissl schwierig mit dem Briefverkehr. Wenn man sich nicht grundsätzlich einig ist über Dinge, muss man halt diskutieren, wenn die Meinungen sehr auseinander gehen, halt streiten – und ich würde sagen, du und ich haben, auf so ziemlich jeder Ebene, die literarische eingeschlossen, das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Da ist der Streit quasi vorprogrammiert. Andernfalls könnte ich nur höflich zu allem schweigen, was du so schreibst – und das wäre dann sicher alles Mögliche, aber kein Brief. Spielplatzmäßig korrekt könnte ich sagen, du willst nicht mit mir spielen, du willst, dass ich deine feinen Förmchen bewundere und die zarten Gebilde, die du damit produzierst.
Wo du schon Hannah Arendt erwähnst – ich wüsste übrigens nicht, warum irgendjemand bezweifeln sollte, dass es wichtig ist, in direktem, physischen Kontakt miteinander zu sein – , tatsächlich ist mir etwas geblieben aus dem Interview, das 1964 Günter Gaus mit ihr führte, und das kam mir zu Beginn dieses Wahnsinns, als ich rundherum sah, wie so viele der Intellektuellen auf Panik-Kurs gingen und die Schotten dicht machten, in den Sinn: „Das war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Ich lebte in einem intellektuellen Milieu, ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, daß unter den Intellektuellen die Gleichschaltung sozusagen die Regel war. Aber unter den anderen nicht. Und das hab ich nie vergessen.“
Mitnichten liegt übrigens eine Pathologisierung vor (entspann dich), wenn ich dein bedächtiges Umrunden in Wald und Flur als verrückt bezeichne – ich denke, als Schriftsteller sollte man zumindest in der Lage sein, mal die Perspektive zu verschieben, ist ja ein ganz probates Mittel, um seine Stoffe von verschiedenen Seiten zu betrachten. Vollführt eine ganze Gesellschaft einen absurden Akt – wie natürlich neben dem Slalomgehen im Park auch die erzwungene Maskierung –, muss man nicht Pathologisieren, wenn man das verrückt nennt. Man muss es nur mal aus einer gewissen Distanz betrachten.
Du und ich, wir werden nicht miteinander ins Spielen kommen, so viel ist klar. Wir sind, um die Metapher auszureizen, Kinder, die, und wenn sie sich alleine zu Tode langweilten, nichts miteinander anfangen können. Nur, weil beides Kinder sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie auch miteinander klarkommen, das ist immer so eine Idee von Erwachsenen. Ich werde darum ehrlich sein. Mir sind Autoren, die so dringend ihre Empfindsamkeit rühmen, suspekt. Ich halte dieses Zurückziehen in einen schallisolierten Elfenbeinturm für möglich, aber nicht gangbar.
Mir geht es dabei nicht um „Schauenlernen“ oder „Hinhören“ – das alles in Ehren, und gerade gibt es, auch abseits von Baustellengeräten, sehr viel zu schauen und zu hören, aber nicht alles, was geschaut und gehört und dann in wohlfeile Wort verpackt wird, ist auch von Interesse. Ich denke mal: Du hast ein Verständnis von Autor-Sein, das ich eher ablehne. Und ich würde mein Hemd dafür wetten: Umgekehrt verhält es sich genauso. Ich finde das übrigens nicht schlimm.
(Kein bisschen bin ich übrigens der Meinung, jeder sollte nun den ultimativen Corona-Roman schreiben, Gott bewahre, was du und ich in unseren Romanen treiben ist eine Sache, eine andere ist es – so wir schon in dieser Zeit einen offenen Briefwechsel führen sollen -, nicht kritisch und mit allen Ambivalenzen über das zu reden, was gerade passiert.)
Das Kreisen um die eigene Befindlichkeit, diese hypersensible Wahrnehmung, das „zu viel an Welt“, die es suggeriert, das alles dient für mich nicht der Selbstaufklärung, was Schreiben im besten Fall sein kann, sondern der Selbstverklärung.
Von Bekenntniszwang: Keine Rede. Argumentiere doch einfach, warum du die weiten Bögen machst im Park und im Wald, und wenn du schon nicht streiten willst, dann nenn es diskutieren, mir kommt das nicht drauf an. Wenn du aber „leise“ sein willst und über diverse Maschinen und dein Schreiben resümieren, bin ich sicher die falsche Ansprechpartnerin – in dieser speziellen Zeit, aber auch sowieso. Kinder inspirieren sich zum Spiel oder sie tun es nicht, das ist bei Autoren nicht viel anders. Wir würden im Sand nicht froh werden zusammen und werden es eben auch auf der Bank nicht. Ich sitz gerade auf der Bank, um ein bisschen zu streiten, aber vermutlich möchtest du eher in Ruhe die Rutsche betrachten.
Da ich deinen Brief nicht kritiklos hinnehmen kann, gäbe es nur zwei Möglichkeiten: Dazu zu schweigen oder zu streiten. Ersteres lehne ich ab, Zweiteres du.
Allzu deutlich wird mir dies alles, wenn ich auf den Schluss deines Schreibens eingehen muss, wo du plötzlich sehr episch wirst und von den „anderen Orten“ sprichst, die „sich seltener äußern mögen, langsamer auch“, und so weiter, weil das ist mir dann doch zu sehr waberndes Geraune, das in dem Satz gipfelt, „Aber sie sind es, die noch da sind, wenn das Licht einmal aus ist.“
Bitte, was für ein Licht? Wenn die Sonne untergeht? Die Welt? Oder nur wir, du und ich und die anderen, wenn wir sterben? Oder ist einfach nur die Glühbirne kaputt? (Ich hatte mal einen Freund, der, wenn die Birne in seinem Zimmer den Geist aufgab, sich zum Lesen in den Flur legte. Monatelang. Klar, man könnte sagen, das ist ein bisschen, du weißt schon, ich will da jetzt nichts pathologisieren oder so, aber er hatte diesbezüglich – „wenn das Licht einmal aus ist“ – eine Konsequenz, an die ich heute noch denke. Ich habe sie nicht, aber ich bewundere sie.) Und dann sind es diese von dir erwähnten Orte, die sich langsam und selten äußern und als harmlos verspottet werden, die dableiben? Wenn ich dich recht verstehe, möchtest du aber diese Orte, ja was eigentlich, bewohnen? In der Hoffnung, dann auch zu bleiben, über deine Worte? Über das Leben – oder das Licht? – hinaus zu wirken? Soll ich daraus schließen, dass du es für wichtiger hältst – und gar die Endlichkeit überdauernd – über diverse Gerätschaften zu schreiben, als sich hier und jetzt mit der diffusen und unruhigen Realität auseinanderzusetzen?
Bemühen wir in dieser Angelegenheit noch einmal Hannah Arendt: „Jetzt fragen Sie nach der Wirkung. Es ist das – wenn ich ironisch werden darf – eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken; aber ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirken? Nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinn, wie ich verstanden habe – dann gibt mir das eine Befriedigung, wie ein Heimatgefühl.“
Ich fürchte, du und ich, wir werden beieinander nicht heimisch werden. Ich will nicht wirken und wir werden – vielleicht sehe ich das zu pessimistisch, aber es ist meine Vermutung – wir werden nicht zu einem gemeinsamen Verständnis kommen.
Wie jedes andere Paar müssen wir auch als Schreib-Paar uns die Frage stellen: Können wir froh werden miteinander? Werden wir Freude haben aneinander und ein Heimatgefühl entwickeln, können wir Spaß haben zusammen? Vor zwanzig Jahren hätte ich womöglich einen Haufen Energie in eine Beziehung gesteckt, die von Anbeginn zum Scheitern verurteilt ist. Heute sehe ich das weitaus nüchterner und würde sagen: Lassen wir das. Mir macht das keine Freude. Gewiss, Beziehungen sind immer auch Arbeit und so – aber sie sollten nicht nur aus Arbeit bestehen. Ich finde immer, das gemeinsame Glück sollte deutlich überwiegen. Hier, bei uns beiden, ahne ich, dass wir uns in erster Linie auf die Nerven gehen werden. Bei solchen Paaren zu Besuch zu sein, ist ja immer ein Elend, dauernd schaut man auf die Uhr und trotzdem vergeht die Zeit nicht – ersparen wir uns und etwaigen Besuchern diese Tortur.
Viele Grüße,
Verena
6. Mai 2020
Verena,
auf der Baustelle machen sie Fortschritte, am Hang steht jetzt eine Mauer, ziemlich hoch und geschwungen, wozu sie gut ist, weiß ich nicht, aber das macht nichts, sie ist trotzdem interessant anzuschauen. Davor sitzen gelbe Baufahrzeuge im Geröll, ein Radlader, ein Vorderkipper, ein Hydraulikbagger, ganz dicht beieinander sind sie geparkt, als hätten sie was zu tuscheln. Vor ihnen drei Arbeiter, einer steht in einem Erdloch, einer lehnt an einer der Maschinen, ein dritter stemmt sich eine Hand in die Hüfte. Schweigend essen sie Eis aus einem Hörnchen, sehen dabei nachdenklich zu Boden, es sieht nach Einkehr aus.
Wenn ich am Schreibtisch nicht weiterweiß, stehe ich auf, gehe hinüber und schaue ihnen zu. Ich fühle mich dem kriechenden Gerät manchmal sehr verbunden, gerade jetzt, da ich ein Kapitel umschreibe, das nicht funktionieren will, und nach und nach liebgewonnene Passagen tilgen muss, es traf mich, als ich den Hydraulikbagger sah, wie er sich die grobe Schaufel vom Arm streifte und eine Art Siebgerät an deren Stelle steckte. Dann begann er, Geröll aus einer Aufschüttung zu lösen, es dauerte, bis er eine feine, bräunliche Masse vor sich hatte, ordentlich schichtete er sie auf, seine metallenen Zacken strichen Muster hinein, zärtlich fast. Später bugsierte er die aussortierten Betonbrocken über das Gelände, schichtete auch sie zu kleinen, kunstvollen Haufen, am Abend dann hantierte er mit einer Art Schere, umfasste eines der Fragmente, immer fester, immer fester, bis es barst, ich schloss das Fenster, konnte es dennoch weiter knacken hören.
Entschuldige, ich weiß, du wolltest eigentlich nichts mehr von der Baustelle hören, weil du der Meinung warst, ich sei verrückt und wir müssten streiten, aber nachdem ich deine Mail gelesen hatte, musste ich erst einmal aufstehen, hinübergehen, den Maschinen zusehen, wie sie sich friedlich brummend ins Erdreich gruben.
Gut, okay, also erst einmal denke ich, dass wir nicht streiten müssen, dass niemand streiten muss, auch „die mündigen Bürger einer Demokratie“ müssen nicht streiten, vielmehr dürfen sie streiten, wenn sie es wollen oder wenn sie sich dazu genötigt sehen, aber sie müssen es ganz bestimmt nicht, weil das Müssen gegenüber der Politik auf ein Mindestmaß begrenzt zu sein hat, die Politisierung innerhalb eines demokratischen Gemeinwesens ist für den Einzelnen Option, nicht Zwang, nur in autoritären und totalitären Systemen ist der Einzelne dazu angehalten, sein Tun und sein Lassen immer und jederzeit an den Sprechweisen und Sprachregelungen des Politischen zu messen.
Gut, okay, wir können also streiten, wenn wir wollen, aber ich weiß eigentlich nicht, ob ich das wirklich will, weil es mich doch wundert: so wenig Streit hattest du, dass du ihn jetzt suchen musst? Mich findet er ziemlich zuverlässig, eigentlich immer, hier schon wieder, und eigentlich kann ich ihn gerade gar nicht brauchen, weil ich eigentlich hier sitzen wollte und mich endlich wieder denken hören wollte, ich wollte endlich wieder einen klaren Gedanken fassen, zu mir kommen, zur Ruhe kommen.
Ich weiß nicht, wo du warst, aber da, wo ich war, ist der Streit nie fort gewesen. Er wütete wie eh und je, nein, er ist schlimmer geworden, weil das, was ihn schon zuvor mehr und mehr verschärft hatte, jetzt zur allumfassenden Voraussetzung geworden ist. Die physische Kopräsenz, die Hannah Arendt in ihrer allzu oft und immer zu unrecht belächelten Theorie des Politischen als grundlegende Bedingung frei handelnder, menschlicher Gemeinwesen erkannt hatte, ist jetzt noch viel weniger möglich, ist jetzt noch viel mehr auf ihre medialisierten Surrogate verwiesen, auf deren inhärente Dynamiken und Zurichtungen – und dabei vor allem auf die Lautstärke, die sich algorithmisch so gut macht, es ist wie bei Zoom, wer am lautesten ist, erscheint im Vollbild und bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Ich kann nicht denken, wenn’s laut ist. Ich kann nicht lesen, wenn’s laut ist. Und schreiben kann ich dann auch nicht. Und wenn ich sofort etwas sagen soll, sofort etwas meinen soll, mit herummeinen soll, bin ich so hilflos wie alle, die gerade versuchen, mit Sinn und Verstand auf ein klitzekleines Wesen, nein, Ding zu reagieren, das wir uns von Atemweg zu Atemweg zuhauchen, bis wir irgendwann, vielleicht, durchseucht sind, immun sind, oder auch nicht.
Um anders zu sprechen, braucht es Zeit. Sonst spreche ich wie alle. Und alle gibt es ja schon. Die können selber sprechen. Dafür brauchen sie mich nicht.
Oder ist dir jeder Versuch des Schauenlernens, des Hinhörens, alle Desautomatisierung von Wahrnehmung und Sprache, schon wertlos geworden, nichts als „harmlose, poetische Betrachtung[]“? Müssen wir jetzt alle diskursiv mobil machen, eine virologische Komplettexpertise behaupten, über die wir unmöglich verfügen können, nur um irgendwen als Insgebüschspringer zu geißeln? Als „Verrückte“? (Übrigens ist die rhetorische Pathologisierung des angenommenen Diskursgegners, da du ja selbst die deutsche und österreichische Geschichte erwähntest, eine eher belastete Tradition.)
Es ist ein Missverständnis, den demokratischen Diskurs mit chorischem Bekenntniszwang zu verwechseln, Chor und Gegenchor, bist du für uns, bist du gegen uns. Es gibt sie, die Orte, an denen gestritten wird, und es soll noch Orte geben, an denen man diskutiert, statt zu streiten. Und es ist gut, dass dem so ist, und es ist gut, dass dort jede und jeder im Takt der Ticker Position beziehen kann. Aber es gibt auch andere Orte. Sie mögen sich seltener äußern, langsamer auch. Sie mögen leiser sein. Und von einigen mögen sie deshalb als harmlos verspottet werden.
Aber sie sind es, die noch da sind, wenn das Licht einmal aus ist.
30. April 2020
Tja, lieber Yannic.
Was soll ich sagen. Jetzt habe ich ewig gebraucht für die Antwort auf deinen ersten Brief, ehrlich gesagt, weil ich diverse Entwürfe jeweils wieder verworfen habe. Ich finde es derzeit nicht so einfach, Briefe zu schreiben – wiewohl ich normalerweise außerordentlich gerne Briefe schreibe, Briefe schreiben ist total herrlich und für Autoren ja recht eigentlich ein eins-a Spielplatz, du weißt schon, einer von denen mit Seilbahn und allem.
Und jetzt quäle ich mich damit herum und muss feststellen: Ich habe jede Leichtigkeit verloren, Spielplätze waren früher irgendwie anders, besser halt, die Schaukeln reißen mich nicht mehr vom Hocker, rutschen, ich weiß auch nicht, und die Seilbahn, naja. Anstatt alles unglaublich aufregend zu finden und mich lustig ins Getümmel zu stürzen, sitze ich blöd auf der Bank und grüble. Nur Langweiler sitzen auf Spielplätzen auf der Bank, darüber sind wir uns ja wohl einig, und plötzlich finde ich mich mitten unter ihnen und: Kann auf deine Spielangebote nicht mehr eingehen.
Worüber ich grüble? Ich bin so hin und her gerissen. Ich befinde mich nachgerade in einem Dilemma: Wir kennen uns nicht, du und ich, wir sind ganz zufällig zu Briefpartnern geworden und unter normalen Umständen, sprich, in Non-Corona-Zeiten, würden wir uns einander höflich und gemächlich annähern (um auf dem Spielplatz zu bleiben: Erst mal nur harmlos nebeneinander her sändeln), wir würden umsichtig abtätscheln, wo der andere eigentlich steht (backt er Kuchen oder arbeitet er an einer regelrechten Burganlage?), wie er so tickt (Matsch oder Trockenmasse), vielleicht also würden wir über Bücher sprechen, über Hobbys, über die bezaubernde Luzidität junger Buchenblätter. Ich spreche rasend gerne über Bücher und Buchen, und Hobbys sind eh super, zum Beispiel gehe ich seit Jahren joggen (wir kommen noch darauf).
In diesen Zeiten aber ist das anders. Ich fürchte, gerade müssen wir uns ein paar Manierlichkeiten schenken und ein bisschen miteinander streiten.
Warum in aller Welt?!, denkst du jetzt vielleicht entgeistert, was hab ich der fremden Frau getan? Ich schreib der ein paar harmlose, poetische Betrachtungen, Eiskugeln, Bagger, da kann man doch prima drauf aufbauen, aber nein, die macht gleich ein Fass auf?
Du hast vollkommen Recht. Eiskugeln und Bagger wären ja quasi das Sandförmchen, das du mir reichst, das Schäufelchen zum gemeinsamen, einträchtigen Schaufeln.
Jetzt aber sitze ich auf der Bank und denke: Ich habe keine Zeit fürs Sändeln und Rutschen – übrigens absolut nicht, weil Rutschen kindisch wäre, Autoren finden kindische Sachen schön, ich finde kindische Sachen schön, ich bin immer gerne gerutscht und ich wünsche mir nichts mehr, als bald wieder nur noch rutschen zu können, Rutschen ist groß.
Aber gerade denke ich, wir können nicht rutschen, wir müssen streiten, weil zu wenig gestritten wurde, in einer Sache, in der der Streit unabdingbar gewesen wäre und dringend nötig, von Anfang an. Er wäre in der Politik dringend nötig gewesen, aber die Opposition hatte den Betrieb eingestellt. Er wäre in den Medien dringend nötig gewesen, aber der kritische Diskurs fiel schlicht und einfach aus, und nicht nur das: Kritik galt ab sofort als Verschwörungstheorie. Er wäre in persönlichen Beziehungen dringend nötig gewesen, aber jeder zog sich in seine Privatsphäre zurück. Er wäre unter Intellektuellen, Autoren und Künstlern dringend nötig gewesen, aber wir haben zu lange geschwiegen. Er wäre dringend nötig gewesen, in allem, und er wäre in einer funktionierenden Demokratie vollkommen normal und selbstverständlich. Diesen Total-Ausfall halte ich für derart dramatisch, dass ich dir gar nicht sagen kann, wie sehr er mich erschüttert. Er erschüttert mich derart, dass ich keine Freude mehr habe am Spielen. Da du ja selbst weißt, wie wichtig das Spielen ist, ahnst du vielleicht, wie es mir gerade geht. Und wie sehr es mir fehlt.
Und darum finde ich: Zumindest wir, du und ich, sollten miteinander streiten, wie es unter mündigen Bürgern einer Demokratie angemessen ist.
Das ist also mein Dilemma. Ich möchte sehr nett zu dir sein, wie ich zu Fremden, die vielleicht zu Freunden werden könnten, gerne nett bin. Aber ich muss mit dir streiten, vielleicht, weil ich hoffe, dass wir dadurch Freunde werden könnten. Denn daran, soviel wage ich jetzt schon zu sagen, daran wird sich in Zukunft Freundschaft messen lassen müssen: Wie wir in dieser Sache denken, um was wir gestritten haben, was verhandelt und gefordert und wie gehandelt.
Reden wir darum über Hobbys. Stichwort Jogger.
Die Leute also, um die du so sorgfältige Bögen machst, denen du so großflächig aus dem Weg gehst, lachen oder schauen dich an wie ein Ungeheuer? Als wärst du, bringen wir es auf den Punkt, verrückt? Nun ja – es ist auch verrückt. Ich gehe selbst spazieren und Leute bleiben stehen, um mich vorbei zu lassen, ich gehe joggen (Hobby) und Leute flüchten sich ins nächste Gebüsch, und ich denke mir: Das sind Verrückte. Noch ein paar mehr, die sich ins Gestrüpp stürzen und sich an Mauern drücken, wenn ich nahe, und ich muss ein paar Scheibenwischer vor dem Gesicht machen, derart verrückt ist es.
Schau. Du wirst – und wenn du dich auf den Kopf stellst – beim Vorbeigehen niemanden, wirklich absolut niemanden anstecken. Du wirst auch nicht angesteckt werden. Es ist nicht möglich. Außer du – und ich unterstelle dir freundlich, dass du das auch vor diesem fahrlässigen und sinnlosen, kosmischen Debakel, in dem wir uns nun befinden, nicht getan hast – außer du bist hochinfektiös, also hustend und prustend und nicht nur das, du hustest und prustest deinen Weggefährten aus nächster Nähe ins Gesicht. Mir persönlich ist das noch nie passiert, ich persönlich habe das noch nie gemacht, ich persönlich kenne niemanden, der das je gemacht hat und auch du wirst, so sehe ich persönlich das, das nie gemacht haben.
Interessant ist zweierlei: Du findest das Verhalten der Frau als auch des Joggers merkwürdig. Warum findest du dein Verhalten nicht merkwürdig? Weil die Regierung sagt, dass man sich so verhalten soll? Also gut, die Regierung sagt, wir sollen uns so verhalten. Heißt das automatisch, dass es richtig, dass es sinnvoll ist? Nein, das heißt es nicht. Wenn wir etwas lernen müssen in diesen aufgebrachten Zeiten, dann dies: Wir müssen uns selber darüber informieren, was richtig ist und was falsch. Da die Massenmedien nach Wochen erst – nach Wochen! – sich irgendwie daran erinnern, was eigentlich ihr Job wäre, nämlich ein breites, vielfältiges und durchaus widersprüchliches Bild der Lage zur Verfügung zu stellen, auf dass wir Bürger uns eine eigene Meinung bilden können, kommt man nicht umhin, mal bei den sogenannten Verschwörungstheoretikern vorbei zu schauen. Interessanterweise waren diese Verschwörungstheoretiker vor diesem Desaster mitnichten Verschwörungstheoretiker, nein, es waren – und es sind -, namhafte Wissenschaftler (Prof. Dr. Bhakdi, Prof. Dr. Ioannidis, Prof. Mölling, um nur einige wenige zu nennen) – oft namhafter und erfahrener, wohlgemerkt, als die paar Experten, sprich: Virologen, die den derzeitigen Diskurs bestimmten. Und sie sagen andere Dinge, als ein Christian Drosten uns sagt und eine Angie Merkel. Und plötzlich gerät die scheinbare „Alternativlosigkeit“, die gerne ins Feld geführt wird, ins Wanken. Stimmt das eigentlich, was da gesagt wird? Diese Frage muss man sich stellen, und man hätte sie von Anfang an stellen müssen. Nein, nicht man: Wir.
Das mit dem Leute-Umrunden und Aus-dem-Weg gehen stimmt jedenfalls nicht. Es ist ein Mythos. Du wirst nirgends, von keinem Experten, irgendeinen Beleg dafür finden, dass sich beim Vorbeigehen Leute anstecken. Es ist reines Placebo. Es ist verrückt.
Das Zweite, was ich interessant finde, ist, dass ich mich frage: Welches Verhalten der Frau und des Joggers fändest du denn angemessen?
Wie gesagt, ich spaziere und jogge ja auch mal gerne und werde von Leuten im großen Stil umrundet, als hätte ich – jaha!: Als hätte ich die Pest (nur, damit wir uns mal wieder die Verhältnismäßigkeit des Ganzen klar machen). Ausdruckslos schaue ich sie an – ausdruckslos, weil, ich erwähnte es, ich muss mich sehr zusammenreißen, nicht wischi-waschi vor dem Gesicht zu machen, ausdruckslos ist das absolute Maximum an Höflichkeit, was ich zustande bringe – und wie schauen die Leute zurück? Ich würde sagen: Irgendwie beleidigt, gekränkt regelrecht, bis hin zu: aufgebracht.
Was wollen diese Menschen? Was willst du?
Sollen wir euch dankbar zulächeln? Quasi der wandelnde Daumen-Hoch? Falls ja (ich unterstelle das jetzt einfach, irre unfair, wie das halt so ist, wenn man sich ein bisschen streitet, ich werde mich SOFORT entschuldigen, wenn ich dir Unrecht getan haben sollte!), also, falls ja: Warum? Wollt ihr Anerkennung für euer Wohlverhalten? Warum? Hier werden „keine Artigkeitsnoten verteilt“, wie Christian Lindner (eigentlich not my favorit, ich schwöre, aber gerade wird ja das Unterste zuoberst gewurlt) das in der Bundestagsdebatte ziemlich treffend auf den Punkt brachte.
Klar, ich versteh schon: Jeder Schüler mag gerne vom Lehrer gelobt werden. Es kann der letzte Blödsinn sein, was der Lehrer da verzapft, aber wenn er mich mit Lob belohnt, lerne ich es, ohne nach dem Sinn des ganzen Krams zu fragen. Das ist das Perfide. Wenn einer geschickt ist darin, dich aufzubauen und dir ein gutes Gefühl zu geben, hat er dich in der Tasche. Du wirst dann blind auch das Falsche tun, weil es gut tut, wertgeschätzt zu werden.
Und was haben wir derzeit? Alle klopfen sich wohlwollend auf die Schulter dafür, dass sie sich brav an die Regeln halten (#stayathome, #flatttenthecurve und Nicht-ohne-meine-Maske – was da halt so an coolen Mit-Mach-Spielchen durch die Netzwerke geistert), es ist, nicht zuletzt, gemeinschaftsbildend. Aber dieser Aktionismus verhindert auch, dass wir uns ganz grundsätzlich und angstfrei fragen: Was an dieser Geschichte stimmt eigentlich? Wo ist bei dieser Sache die gesunde Skepsis, die bei wichtigen Entscheidungen immer angebracht ist – und doch erst recht, wenn es um so viel geht? Was wären mögliche Alternativen? Zu denken und zu handeln? Ich finde es höchst merkwürdig, dass diese Skepsis und diese Fragen ausblieben – sie sind was ganz Normales und Wichtiges, sie dienen als Regulans.
Ich meine, es ist angebracht, sich spätestens jetzt von dieser Art der Wohlgefälligkeit zu lösen. Dass eine Mehrheit etwas genau so für richtig hält und das auch nicht diskutieren möchte, hat noch nie geheißen, dass es auch das Richtige ist. Wir in Deutschland und Österreich sollten das sehr gut wissen.
Ich bin als Kritikerin nicht in der Bringschuld, es bin nicht ich, die etwas beweisen muss. Die Regierungen, die Staaten, haben eine ungeheure Entscheidung getroffen, die ungeheure Folgen hat und noch lange haben wird, und sie sollten sehr, sehr gut beweisen, dass es richtig war. Dass es nötig war. Denn „Alternativlos“, sagt Juli Zeh zu dieser Sache, „ist ein anderer Begriff für „Keine Widerrede!“ und damit ein absolut undemokratisches Konzept.“
Schau, ich streit hier alleine mit dir herum, dabei bist du vielleicht (wahrscheinlich, ziemlich sicher, also auf gar keinen Fall) auf Streit aus. Vermutlich tue ich dir, wie‘s beim Streiten halt so geht, gnadenlos unrecht, vermutlich vertu ich mich im Ton, vermutlich irre ich mich in allem Möglichen. Verzeih mir, falls dem so ist. Gerade muss ich ein bisschen auf der Bank am Spielplatz sitzen und habe keine Lust zu spielen. Es ist so nett von dir, dass du vorbei kommst und mir deine Spielgeräte anbietest und dass ich zuerst auf die Seilbahn darf, unter allen anderen Umständen hätten wir einen grandiosen Tag mit Spielplatzfreuden verbracht und wären abends müde aber glücklich nach Hause gekommen: Wieder ein durch und durch gelungener Autorentag. Aber weißt du: Ich denke, wir sollten alle miteinander aus der Deckung kommen. Lieber ist es mir, dass wir uns lauthals verrennen und uns dann entschuldigen müssen dafür, als zu Unrecht zu schweigen. Gerade passiert viel Unrecht. Magst du dich zu mir auf die Bank setzen und ein bisschen streiten?
Ich möchte nicht von mir sagen müssen, ich hätte von nichts gewusst.
Soweit.
Herzliche Grüße,
Verena
17. April 2020
Verena,
die Eisdiele war geschlossen, aber das lag am Wetter, jetzt hat sie geöffnet, trotz Corona. Innen ist es dunkel, man muss genau hinsehen, dann erkennt man den Verkäufer im karierten Hemd, er trägt blaue Handschuhe aus Gummi, schält Kugeln aus den gekühlten Behältern, ein unendlich schmaler Junge steht vor dem Glas, zeigt mit dem Finger auf die Sorten. Als er fort ist, tritt der Verkäufer hinaus in die Sonne, schaut sich um, stemmt die Hände in die Hüften. Gegenüber schlendert eine Frau im Schatten der Gebäude, allein, in ihrer Linken ein üppiger Strauß Tulpen, der Blumenladen hat geöffnet, der Buchhändler nicht.
An der Baustelle rührt sich nichts mehr. Kürzlich noch riesige, spinnenartige Maschinen, die sich am Hang zu schaffen machten, ihn zurechtbaggerten, glatt walzten, dann mit Beton bespritzten, aus einer Düse, die ein Bagger am senkrecht erhobenen Arm in die umgegrabene Böschung richtete. Irgendwann fiepende Lastwagen, die vorgegossene Bauteile lieferten, ein Schwerlastkran hievte sie in die Vertiefungen, die offenbar für sie angelegt worden waren, wie hohle Zähne stehen sie nun im Gefälle, verlassen.
Ich erinnere mich an die Frau, die mich ansah, irritiert, verstört beinah, als ich stehenblieb, um sie passieren zu lassen, um Abstand zu halten, aber sie verstand nicht, betrachtete mich wie ein eigenartiges Ungeheuer, trippelte langsam an mir vorbei, ohne mich aus den Augen zu lassen, blickte sich noch mehrfach um, wie sie sich entfernte. Einmal auch ein Läufer im Wald, ich ging zur Seite, trat sogar ins Gestrüpp, und er lachte, rief mir nach, so dick bin ich nicht.
Inzwischen die ersten maskierten Menschen auf der Straße. Ein Mann mit Sauerstoffflasche in der Rollatortasche, ein Schlauch führt ihm zur Nase, langsam schiebt er das Gestell über den Gehweg, blickt zu mir auf, als ich vorbeikomme, ängstlich fast, er zieht an den Bremsen, die an den Haltegriffen sitzen, dabei gehe ich schon einen weiten Bogen, ich kann ihn verstehen.
So ist es hier, Verena. Wie ist es dort?
Yannic
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von Literaturhaus Liechtenstein, Literaturhaus & Bibliothek Wyborada, dem SAAV und literatur.ist.